T.C. Boyle: I walk between the raindrops. Carl Hanser
sprachlich gut, aber deprimierend
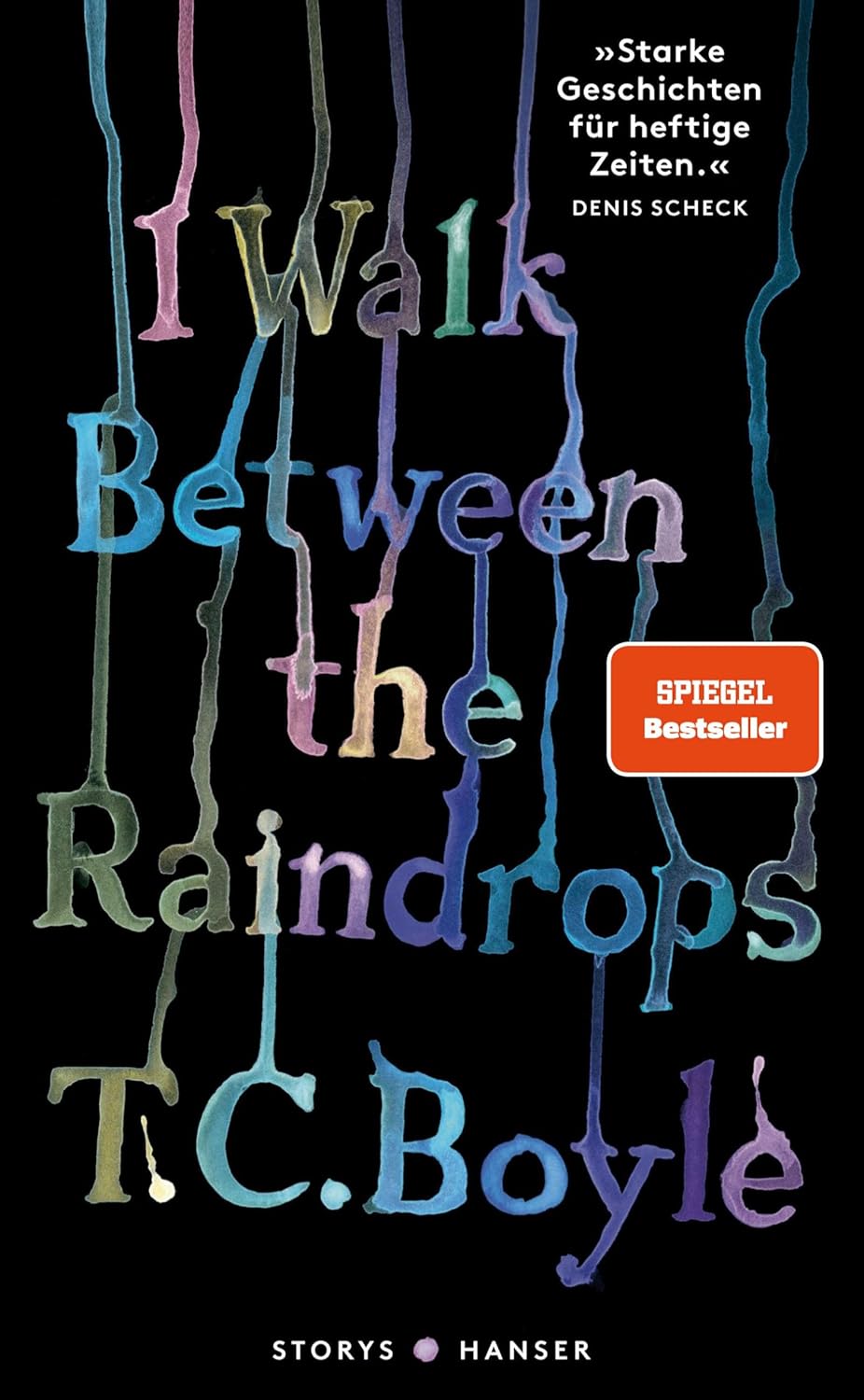 Die Sammlung von 13 Kurzgeschichten des bekannten Autors hat mich zunächst irritiert, denn was ich bekam, waren Schnipsel: genau beobachtete und atmosphärisch sehr dicht geschilderte Szenen – aber ohne Anfang und ohne Ende. Bald erkannte ich, dass das zumindest zum Teil der e-book-Formatierung geschuldet war, die unklar werden ließ, ob es sich um eine Zwischenüberschrift handelt oder um eine neue Geschichte. Daher purzelte ich immer wieder aus Texten heraus oder – wenn ich dachte, hier gehe der Text weiter – in einen neuen Text hinein. Da manche Geschichten die Perspektiven wechseln, hatte ich arge Mühe damit, zu verstehen, wann ein Text zu Ende war und wann ein neuer beginnt, denn Zwischenüberschriften waren fett gedruckt und ebenso mitten auf der Seite wie die einfachen Überschriften, die oft nicht einmal Absätze bekamen und denen zu allem Überfluss noch die Leerzeichen fehlten. Hinzu kommt, dass Boyle keine klassischen Enden schreibt: Wir sehen seinen Figuren eine Weile lang zu, sie erleben etwas (meist Deprimierendes) und dann wenden wir mit dem Autor den Blick ab und bleiben mit unseren Gedanken allein. Ich fand das zunächst anregend, es hat mich dann aber doch zunehmend genervt, bekam ich doch mehr und mehr das Gefühl, dass Boyle seine Figuren vorführt, benutzt, und sich dann von ihnen abwendet, wenn ihm nichts mehr einfällt oder er sich nicht wirklich weiter mit ihnen auseinandersetzen will.
Die Sammlung von 13 Kurzgeschichten des bekannten Autors hat mich zunächst irritiert, denn was ich bekam, waren Schnipsel: genau beobachtete und atmosphärisch sehr dicht geschilderte Szenen – aber ohne Anfang und ohne Ende. Bald erkannte ich, dass das zumindest zum Teil der e-book-Formatierung geschuldet war, die unklar werden ließ, ob es sich um eine Zwischenüberschrift handelt oder um eine neue Geschichte. Daher purzelte ich immer wieder aus Texten heraus oder – wenn ich dachte, hier gehe der Text weiter – in einen neuen Text hinein. Da manche Geschichten die Perspektiven wechseln, hatte ich arge Mühe damit, zu verstehen, wann ein Text zu Ende war und wann ein neuer beginnt, denn Zwischenüberschriften waren fett gedruckt und ebenso mitten auf der Seite wie die einfachen Überschriften, die oft nicht einmal Absätze bekamen und denen zu allem Überfluss noch die Leerzeichen fehlten. Hinzu kommt, dass Boyle keine klassischen Enden schreibt: Wir sehen seinen Figuren eine Weile lang zu, sie erleben etwas (meist Deprimierendes) und dann wenden wir mit dem Autor den Blick ab und bleiben mit unseren Gedanken allein. Ich fand das zunächst anregend, es hat mich dann aber doch zunehmend genervt, bekam ich doch mehr und mehr das Gefühl, dass Boyle seine Figuren vorführt, benutzt, und sich dann von ihnen abwendet, wenn ihm nichts mehr einfällt oder er sich nicht wirklich weiter mit ihnen auseinandersetzen will.
Trotz dieser Mängel fingen mich die Texte immer wieder ein, vor allem als ich begriff, dass ich in meinem e-book nach den Enden und Übergängen forschen sollte. Dann wurde nämlich durchaus klar, was zusammengehört und wie geschickt Boyle verschiedene Perspektiven in einer Geschichte verwebt. Er kann gut beobachten und dies in Worte fassen, findet eigenwillige Vergleiche, die neu sind und manchmal trotzdem so klingen, als hätte ich sie schon tausendmal gelesen: „“Wie aufmerksam“, murmelte sie, nahm mit der einen, beinahe durchscheinenden Hand die Blumen …“ Oder, noch besser: „Er bekam nicht viel mit von dem, was geschah, außer dass das Sonnenlicht die Windschutzscheibe des Wagens explodieren ließ wie eine Supernova und der Klang der Sirenen sich wie Tentakel um seinen Kopf legte.“ Hier zeigt sich Boyles Neigung zur Zuspitzung und Übertreibung. Er stellt kleine Beobachtungen neben existenzielle Erlebnisse, da geht es um Leben und Tod und immer wieder um Alkohol. In jeder Geschichte wird nicht nur getrunken, sondern das Trinken zelebriert, häufig neben dem Rauchen. Sämtliche seiner Figuren scheinen dem Alkoholismus verfallen. In den ersten Texten spielt ein gehobener Lebensstil eine große Rolle, die Figuren haben Haushälterinnen und in der Quarantäne-Geschichte, in der ein Paar auf einem Kreuzschiff in Quarantäne gerät, besteht ein ausführlich beschriebenes Problem darin, dass niemand für sie dreimal wöchentlich die Bettwäsche wechselt. Wie es dem Paar miteinander geht, erfahren wir dagegen nicht.
Mich hat es zunächst fasziniert, wie jede Figur ein Archetyp zu sein scheint: die bemühte Lehrerin, die Frau, die immer shoppen geht (alle Frauen bei Boyle gehen ständig einkaufen), der Mann, der in der Kneipe auf seine einkaufende Frau wartet, der INCEL, der eine Frau von seiner Weltsicht überzeugen will usw. Die meisten Erzählungen sind Ich-Erzählungen und fast immer aus der Sicht eines weißen Mannes geschildert, der seine Einsamkeit wegtrinkt und versucht, eine Frau ins Bett zu bekommen, weil er sich nicht eingestehen kann, dass er eigentlich ein Mittel gegen seine Minderwertigkeitsgefühle und keinen Sex will. Natürlich ist dann der nicht beschriebene, aber stattfindende Sex auch keine Hilfe: Boyles Figuren sind immer verloren, einsam, nicht mit sich in Kontakt und sie gehen mit bewertenden Blicken durch die Welt. Andere Menschen sind zu fett oder zu dürr, zu wenig schön (Schönheit ist in dem Buch eine wichtige Kategorie sowohl für Frauen als auch für Männer, andere Geschlechter kommen nicht vor) oder zu wenig intelligent: „… und machte eine Show daraus, sich die Lesebrille auf den knickrig kleinen Knollen seiner billigen Stupsnase zu klemmen ...“ Dabei wird nicht nur ein erbarmungsloser Blick auf dicke, arme oder kranke Menschen geworfen, sondern auch auf die Erzählfigur, die diese entwertet. Meist handelt es sich um verbitterte, einsame, sozial unfähig und dauerwütende Figuren, besonders gut herausgearbeitet in „Die Form einer Träne“, in der wir aus der Sicht des Sohnes und der der Mutter erfahren, warum sie sich entscheidet, den eigenen Sohn aus dem Haus zu klagen. Das hat mich berührt. Aber: in jeder Geschichte ist eine derartige unsympathische Hauptfigur vorhanden, niemand kann wirklich miteinander reden. Vergeblich suchte ich nach Mitgefühl oder Sympathie in mir, irgendwann war ich so abgestoßen, dass ich die letzte Geschichte nicht mehr lesen wollte. Ich mochte mich beim Lesen dieser Geschichten nicht; mochte nicht, wen sie aus mir machten. Gleichzeitig faszinierte mich die Sprache, die beiläufige Grausamkeit, mit der beispielsweise die Hauptfigur beobachtet, wie die Frau in der Nebenkabine eines Kreuzfahrtschiffes tot aufgefunden wird. Irgendwann rückte mir die Leere so nahe, dass ich mich für den Abbruch entschied (meine Rezension beinhaltet nur 12 Geschichten).
Die Sammlung wird als abgründig-witzig beworben, allerdings habe ich darin so gut wie keinen Humor finden können. Dafür aber eine Menge Schadenfreude. Die Plots sind oft grausam gegenüber den Figuren, ebenso wie die Art, über sie zu berichten, die sich mitunter über ihr Elend lustig macht, was mir besonders bei dem Text über die beiden dicken Personen aufstieß, die miteinander verkuppelt werden sollen, nur weil sie beide dick sind. Boyle schildert den Selbsthass des dicken Freundes schonungslos und unverstellt – und gleichzeitig auf eine Weise, die es schwer macht, Mitgefühl zu entwickeln.
Näher eingehen möchte ich auf die beiden Geschichten, die der Science-Fiction zuzuordnen sind, wobei Spoiler nicht immer zu vermeiden sind (da die Texte nicht von klassischer Spannung leben, sind Spoiler aber meines Erachtens nicht schlimm). Wegen oben benannter Formatierungsprobleme kann ich allerdings leider keine Garantie dafür übernehmen, dass ich die Inhalte richtig zuordne.
Der erste SF-Text, „Schlaf am Steuer“, hat mehrere Handlungsstränge: Da ist eine Anwältin, die sich für Obdachlose einsetzt, die zum Opfer von Sicherheitsrobotern werden. Ihr KI-gesteuertes Auto fährt sie dabei nicht nur zu ihren Terminen, sondern entwickelt auch eine eigene Meinung. So animiert das Auto sie dazu, eine Tasche zu kaufen, und weigert sich, einen Obdachlosen zu fahren, als sie diesen zu sich einladen und verführen möchte.
Die zweite Handlungsebene schildert ihren Sohn, der KI-gesteuerte Autos nutzt, indem er illegal auf ihrem Dach mitfährt. Gemeinsam mit seinen Freund*innen, mit denen er die Schule schwänzt, entwickelt er die Idee eines illegalen Autorennens als Mutprobe. Dafür müssen sie die Autos hacken, was aber nicht vorhersehbare Folgen hat. Wie die meisten Texte hat auch dieser ein offenes Ende, da das Auto aber mit verschlossenen Türen und den Teenagern im Innenraum auf eine Klippe zurast, ist recht vorhersehbar, was passieren wird.
Boyle entwickelt hier zwar eine zukünftige Welt, aber die Autos und Roboter sind das einzige SF-Element. Alles andere ähnelt eher einem trostlosen 1950er USA-Kleinstadt-Vorort, inklusive der gelebten Geschlechtsrollenbilder, in der Sie helfen will und Er den Macker gibt, wobei das Motiv beider gleichermaßen in Langeweile zu bestehen scheint. Mutter und Sohn leben nebeneinander her, sie ist so einsam, dass sie mit dem Obdachlosen schläft, ohne dass verständlich wird, warum, und er setzt sein Leben aufs Spiel, ohne dass sie eine Ahnung davon hat oder klar wird, warum er das tut. Der Text ist atmosphärisch dicht und spannend, er schildert jene Verlorenheit und Unverbundenheit, die jeden der hier versammelten Texte durchzieht. Gleichzeitig bleibt Boyle stets auf Distanz zu seinen Figuren: Wir können ihre Einsamkeit und ihren Schmerz nur ahnen, die Motive für ihr Handeln bleiben vage. Das SF-Element spielt für die Handlung meines Erachtens keine Rolle, es verstärkt nur die in allen Texten vorhandene surreale Wirkung, die meines Erachtens durch die unterkühlte Art zu beobachten und die eigenwilligen Vergleiche entsteht.
Der zweite SF-Text „SKS 750“ spielt ebenso wie der erste in der sehr nahen Zukunft. Ich lese den Handlungsort als eine chinesische Großstadt, wobei in mir als Person, die nie in China war und kaum etwas darüber weiß, der Eindruck entsteht, dass hier ein China gezeigt wird, wie es sich weiße Leute vorstellen. Zentral für den Text ist ein Punktesystem, bei dem Bürger*innen für Wohlverhalten Punkte gewinnen und für Fehlverhalten abgezogen werden. Das Ganze funktioniert mithilfe eines umfassenden Überwachungssystems. Die SF-Komponente ist (wahrscheinlich), dass die Handys von Personen in der dem Punktestand zugeordneten Farbe leuchten, so dass leicht erkennbar ist, wer wie viele Punkte hat.
Die Hauptperson der Geschichte, ein Mann Mitte dreißig, ist genauso ein Arschloch wie die Hauptfiguren in den anderen Geschichten Boyles: soziale Beziehungen sind für ihn nur pflegenswert, wenn sie ihn weiterbringen. So ist es kein Wunder, dass der Mann sowohl seine neue Geliebte als auch den langjährigen „besten Freund“ fallen lässt, als diese unter einen bestimmten Punktestand fallen. Dabei fällt mir auf, dass es eine Parallele zu dem Text über die dicke Freundin gibt: Dort ist Schlanksein und Dem-Schönheitsideal-Entsprechen die Währung, hier ist es der Punktestand. Auch in „SKS 750“ schaut die Erzählfigur bewertend auf Personen, alle Frauen werden, wie sie oft in Boyles Texten „Mädchen“ genannt und Sex will man nur um des Sex’ Willen – ein Interesse an den Personen besteht unabhängig vom Geschlecht nicht. So ist das zwar eine Geschichte, die (wahrscheinlich) in China und in der Zukunft spielt, die Figuren und Geschlechterbilder unterscheiden sich aber nicht von den anderen Texten, auch wenn der Text nahelegt, dass die Hauptfigur Chinese sein soll (in allen anderen Texten sind die Hauptfiguren US-amerikanisch oder europäisch).
Fazit: T.C. Boyle beherrscht das schreiberische Handwerk meisterhaft. Er kann Stimmungen erzeugen, Bilder erzeugen und gleichzeitig einen sprachlichen Fluss hervorrufen, der einen beeindruckenden Sog erzeugt. Mich konnte die Sammlung trotzdem nicht überzeugen und zwar einerseits aufgrund der deprimierenden Weltsicht und andererseits aufgrund der alle Texte durchziehenden Entwertung inklusive Sexismus, Ableismus, Saneismus und Rassismus. Boyle schreibt meisterhaft über gebrochene, einsame, unverbundene Figuren, der sich stets wiederholende Untergang dieser Figuren hat mich aber auf Dauer ermüdet und deprimiert.
Unterhaltung: 2,5 von 3
Sprache/Stil: 3 von 3
Spannung: 2 von 3
Charaktere/Beziehungen: 1,5 von 3
Originalität: 1,5 von 3
Tiefe der Thematik: 1,5 von 3
Weltenbau: 1 von 3
Gesamt: 13 von 21
