Melanie Wylutzki und Hardy Kettlitz: Das Science Fiction Jahr 2025. Hirnkost
anregend und gespalten
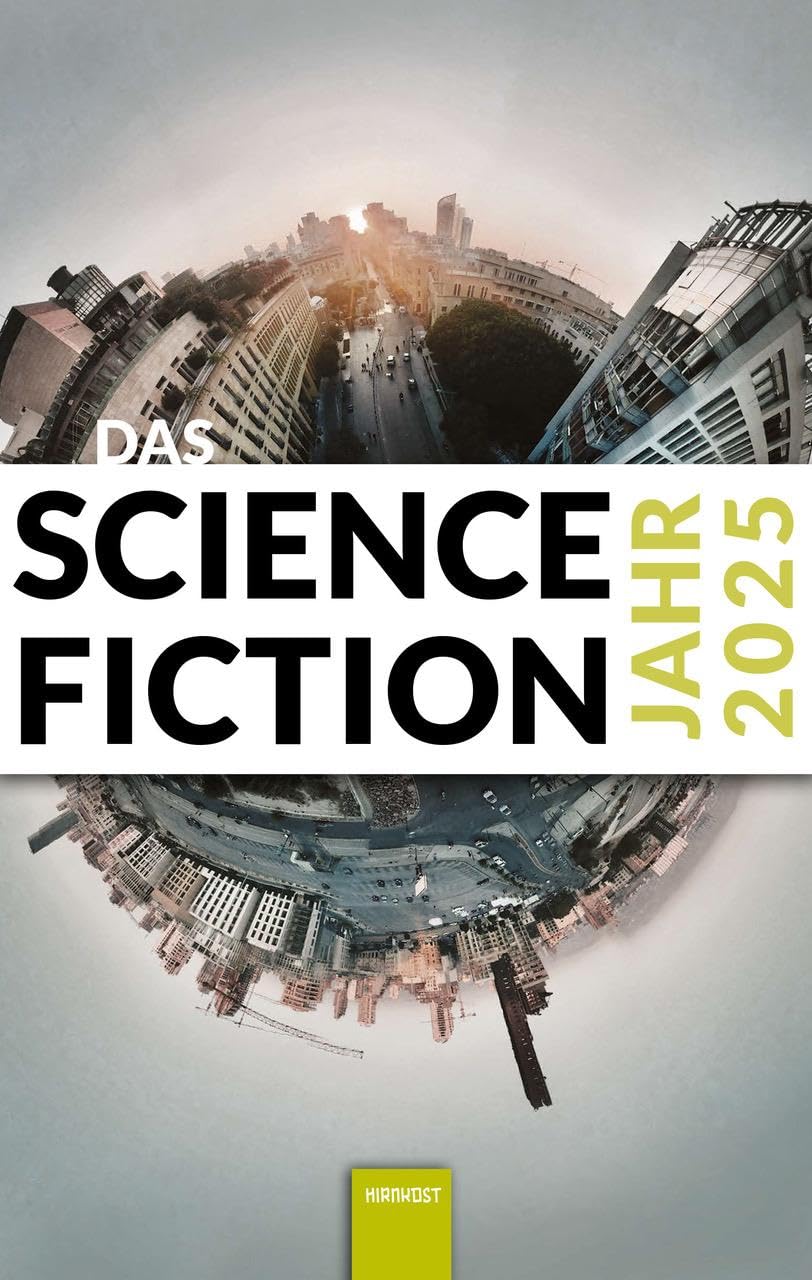
„Das Science Fiction Jahr“ (in der Publikation durchgängig ohne die nach Duden richtigen Bindestriche geschrieben, weshalb ich diese Schreibweise hier übernehme) ist eine jährlich erscheinende Sammlung von Sachtexten. Essays, Rezensionen und Rückblicke verschiedener Autor*innen reihen sich auf 515 Seiten aneinander. Obwohl ich „Das Science Fiction Jahr“ schon seit einigen Jahren lese, habe ich mich bislang nie dazu aufraffen können, es zu rezensieren. Denn wie soll ich der Menge der Texte gerecht werden? Diesjahr hat mich diese Sammlung aber so bereichert, dass ich unbedingt versuchen möchte, sie mit einer Rezension zu feiern. Hinzu kommt, dass mit der Insolvenz des Hirnkost Verlags die Zukunft des Projektes (mal wieder) auf dem Spiel steht. Zu oft habe ich in den letzten Monaten gehört, dass sich so ein Projekt überlebt habe, es nicht mehr zeitgemäß sei, sich keine Leser*innenschaft dafür finden ließe. Aber ist das wirklich so?

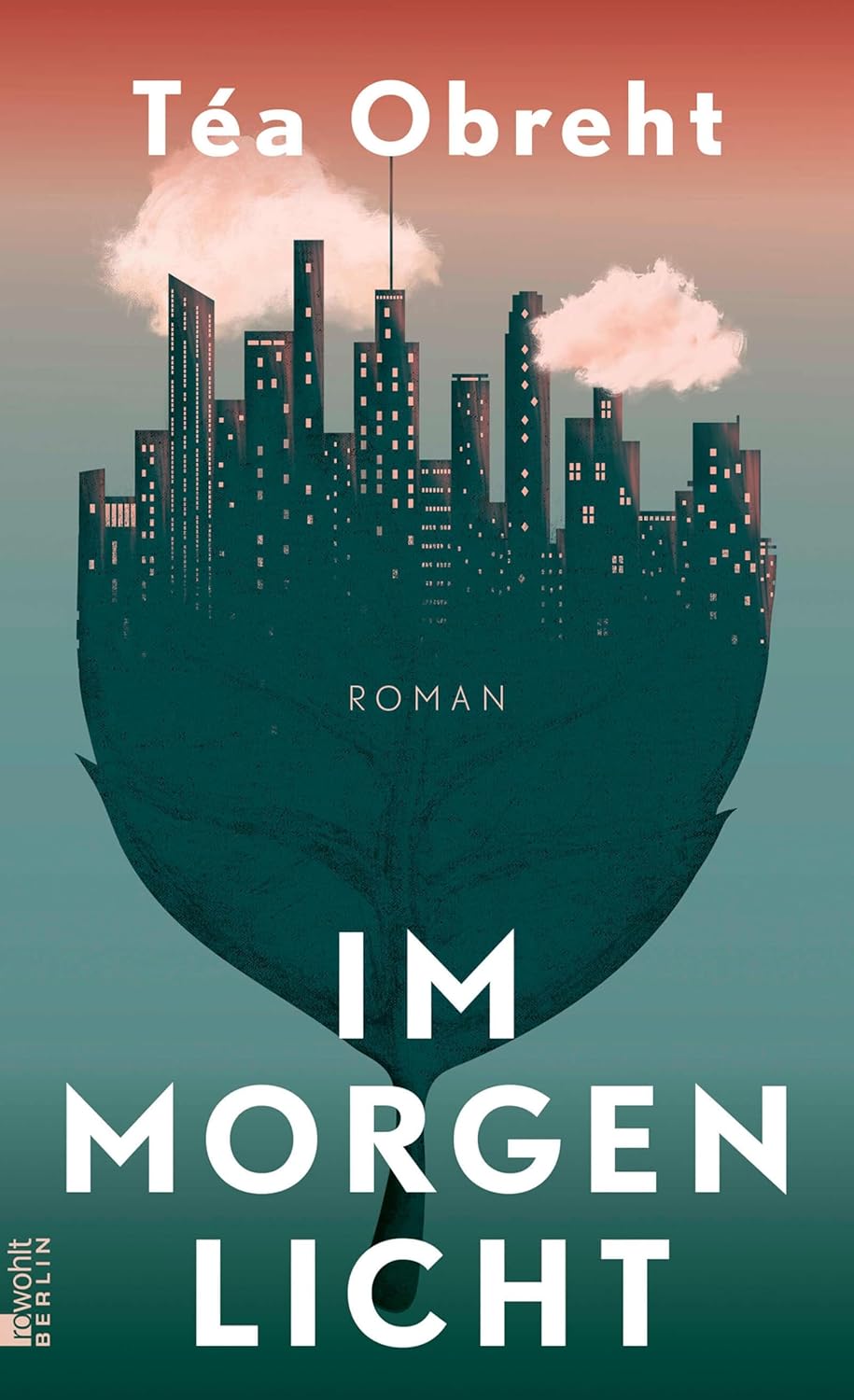
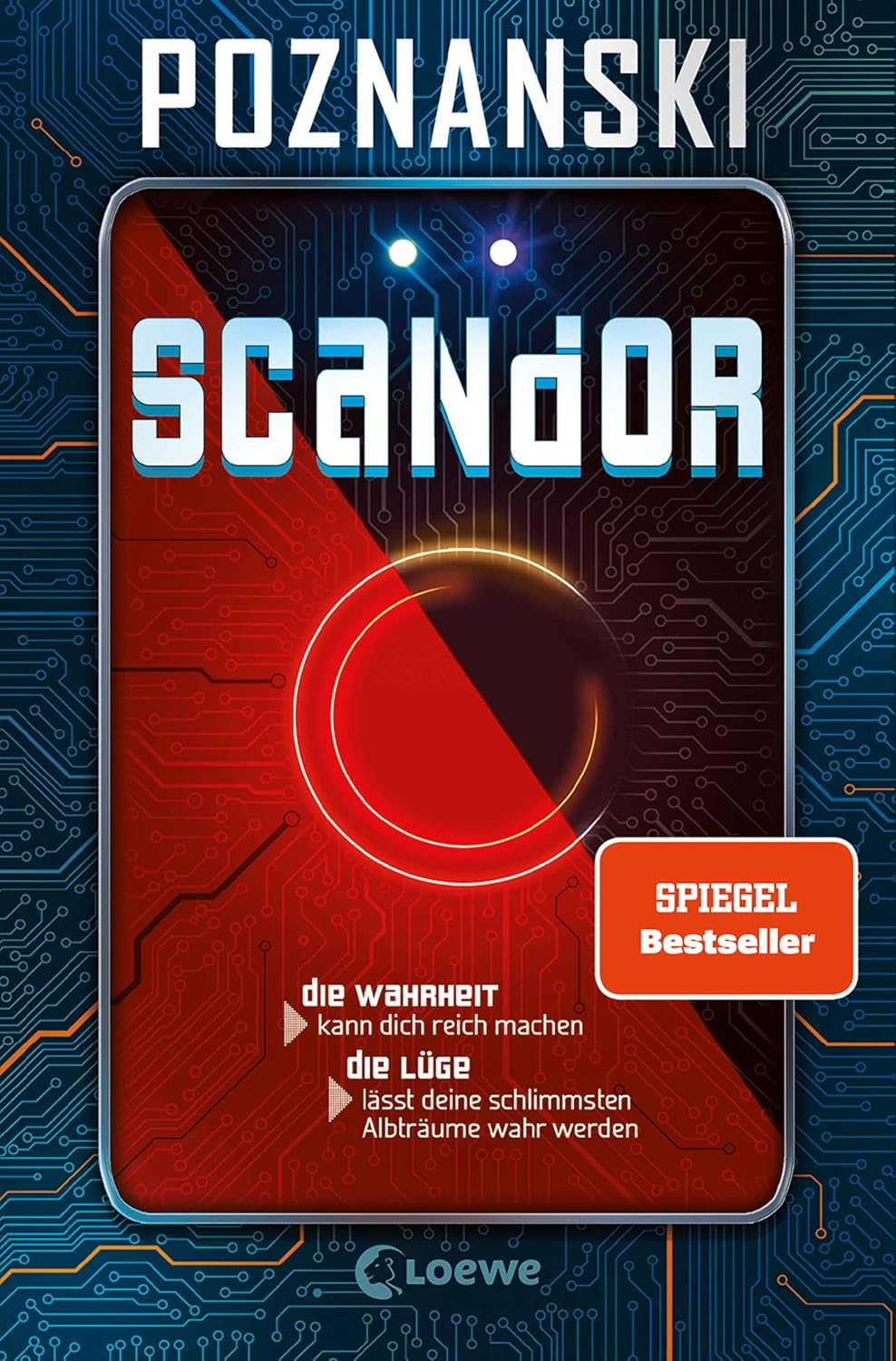 Stell dir vor, du könntest nicht mehr unerkannt lügen. Diese Grundidee beschäftigt mich seit Jahren, weshalb sie im Weltenbau von „Das Geflecht“ eine große Rolle spielt. Poznanski hat keinen neuen Sinn, sondern eine Maschine erfunden: den perfekten Lügendetektor. Einhundert Menschen sollen ihn um die Wette verwenden. Wer als längstes durchhält, gewinnt fünf Millionen Euro.
Stell dir vor, du könntest nicht mehr unerkannt lügen. Diese Grundidee beschäftigt mich seit Jahren, weshalb sie im Weltenbau von „Das Geflecht“ eine große Rolle spielt. Poznanski hat keinen neuen Sinn, sondern eine Maschine erfunden: den perfekten Lügendetektor. Einhundert Menschen sollen ihn um die Wette verwenden. Wer als längstes durchhält, gewinnt fünf Millionen Euro.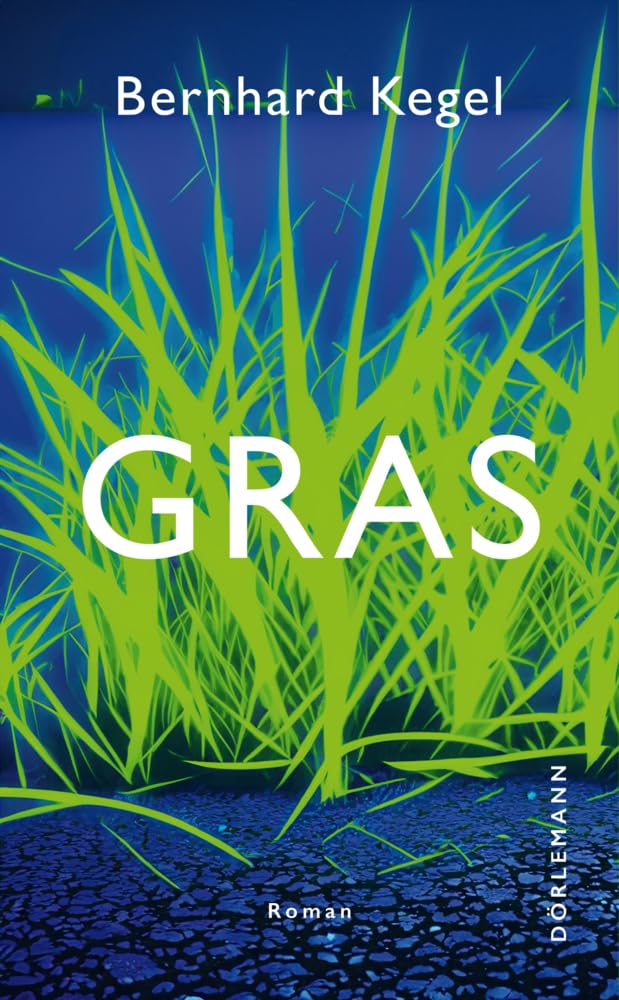 Im Berlin unserer Jetztzeit breitet sich ein bislang unbekanntes Gras aus und wächst und wächst und wächst. Worüber sich die Menschen zunächst freuen, scheint doch die Natur dem Klimawandel zu trotzen, entwickelt sich mehr und mehr zur Katastrophe: Straßen und Gehwege werden unpassierbar, die Logistik bricht zusammen.
Im Berlin unserer Jetztzeit breitet sich ein bislang unbekanntes Gras aus und wächst und wächst und wächst. Worüber sich die Menschen zunächst freuen, scheint doch die Natur dem Klimawandel zu trotzen, entwickelt sich mehr und mehr zur Katastrophe: Straßen und Gehwege werden unpassierbar, die Logistik bricht zusammen.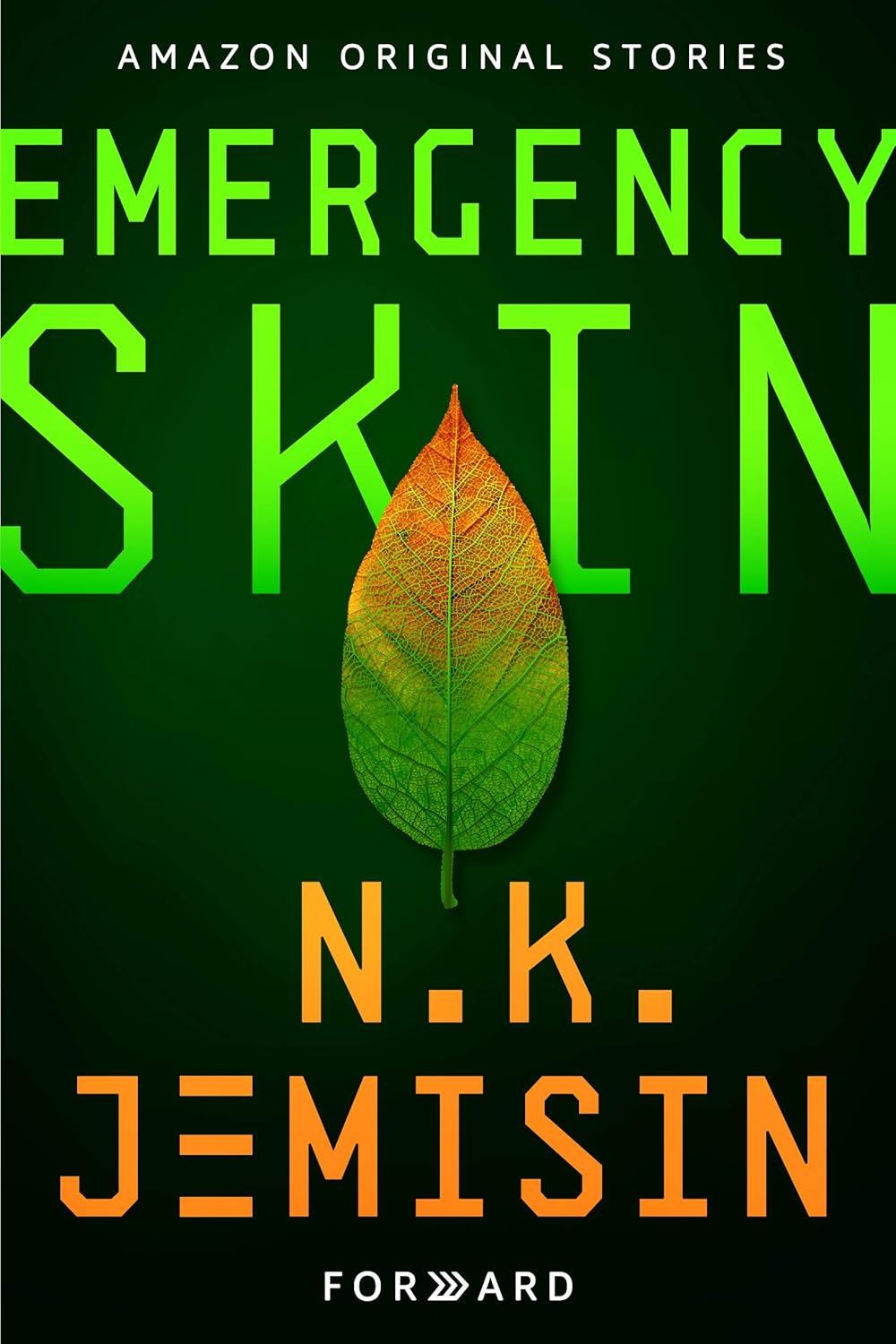
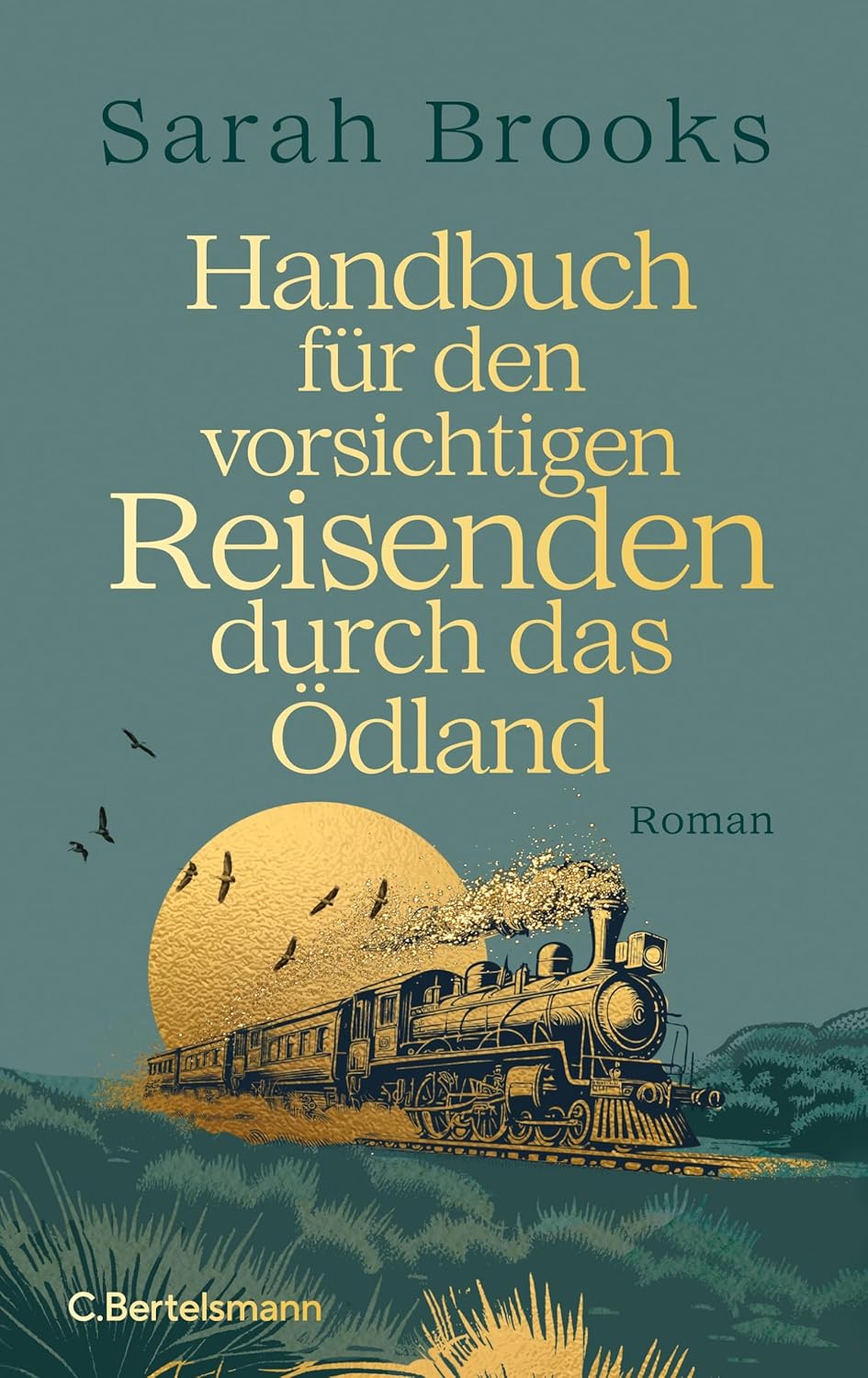 Zwischen Russland und China erstreckt sich das Ödland: eine geheimnisvolle Region, in der sich die Lebewesen verändert haben. Sie ist mit einer hohen Mauer abgesperrt und nur ein Verkehrsmittel fährt hindurch, um Europa und Asien zu verbinden: der Zug. Luftdicht abgeschottet und gut bewacht, rast er durch das Ödland, transportiert Waren, Menschen und deren Vorräte, damit sie die dreiwöchige Reisezeit überstehen. Im Zug gibt es eine erste und eine dritte Klasse, warum die zweite fehlt, weiß niemand.
Zwischen Russland und China erstreckt sich das Ödland: eine geheimnisvolle Region, in der sich die Lebewesen verändert haben. Sie ist mit einer hohen Mauer abgesperrt und nur ein Verkehrsmittel fährt hindurch, um Europa und Asien zu verbinden: der Zug. Luftdicht abgeschottet und gut bewacht, rast er durch das Ödland, transportiert Waren, Menschen und deren Vorräte, damit sie die dreiwöchige Reisezeit überstehen. Im Zug gibt es eine erste und eine dritte Klasse, warum die zweite fehlt, weiß niemand.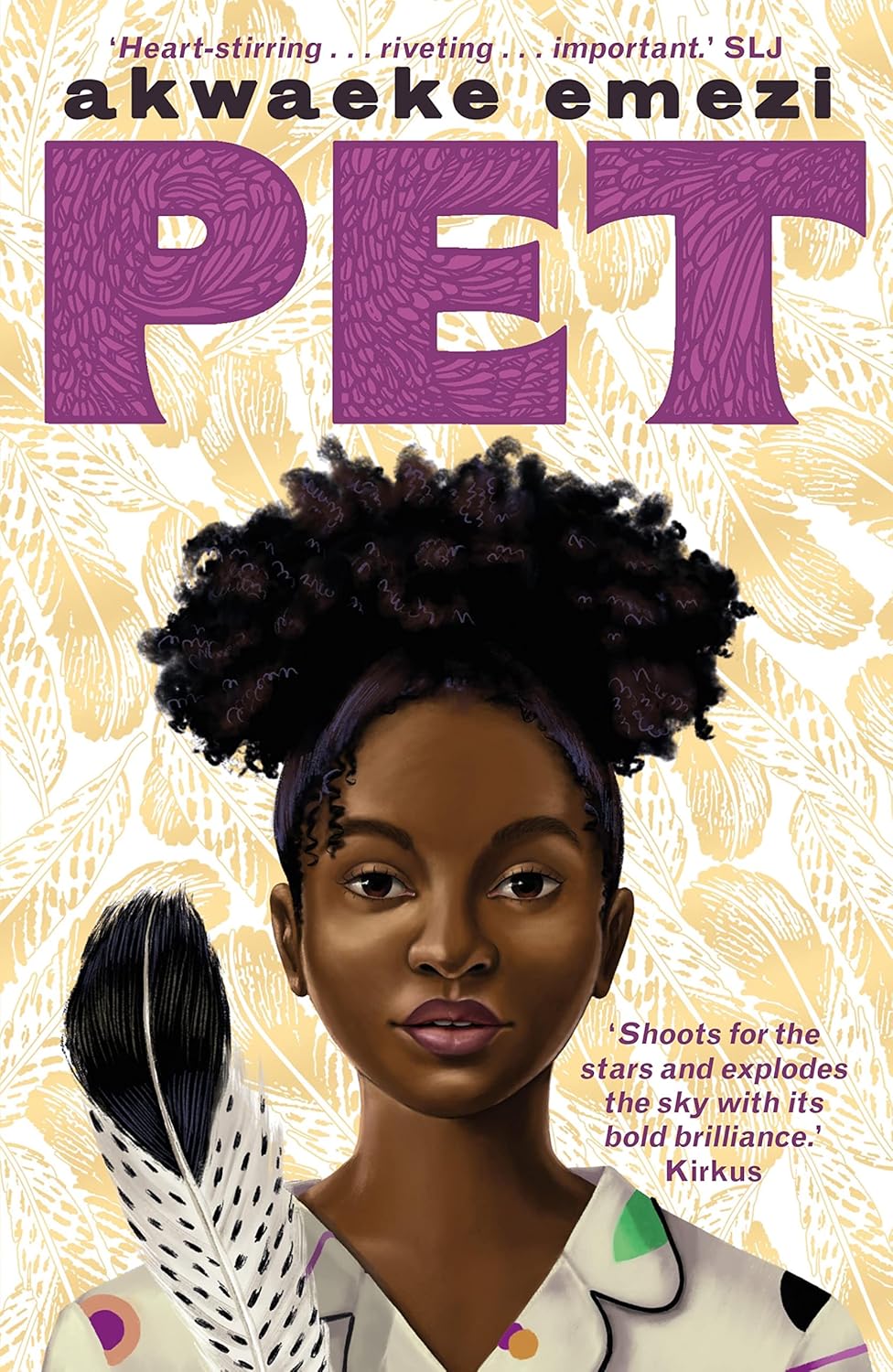
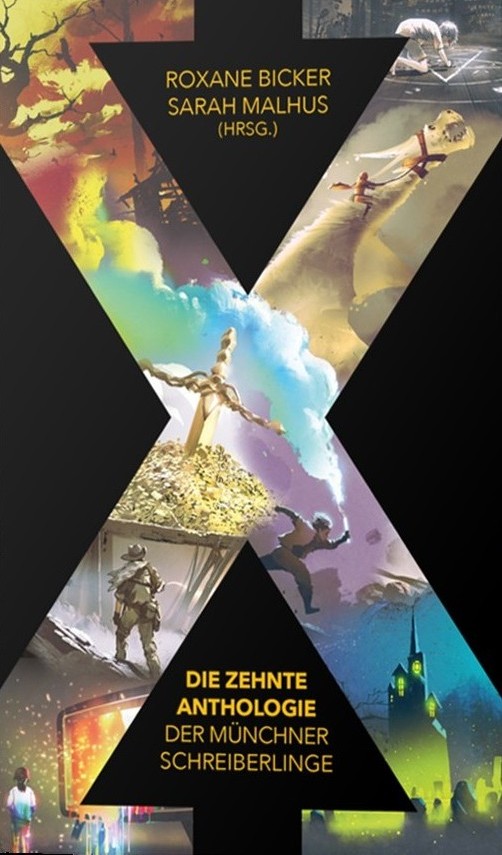 Dani Aquitaine: Das zehnte Kind
Dani Aquitaine: Das zehnte Kind