Hilary Leichter: Luftschlösser. Arche
verwirrend und originell
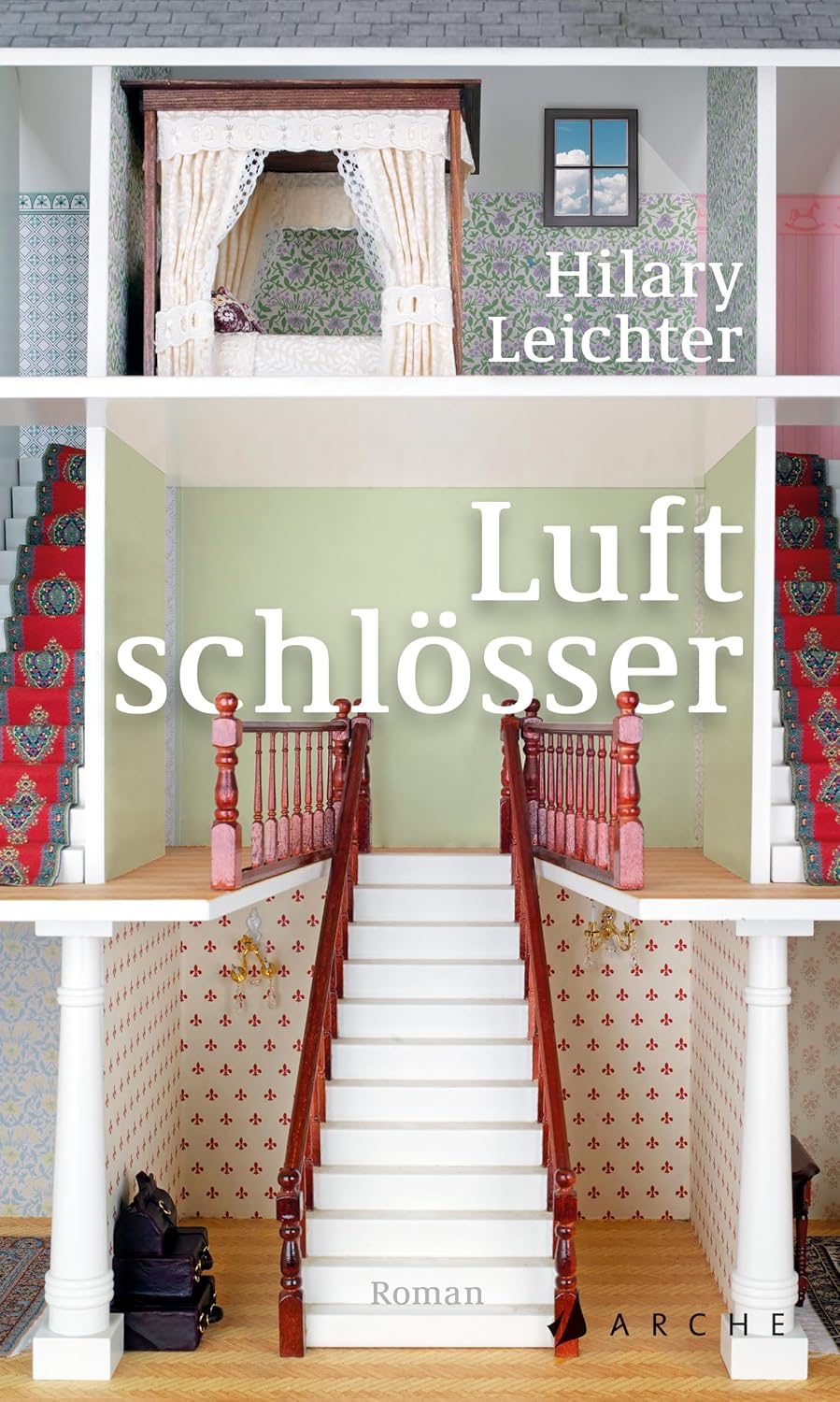 Ein heterosexuelles Paar lebt mit seinem Baby in einer zu kleinen Wohnung und leidet unter Armut und Enge. Als sie eine Kollegin einladen, vor der ihnen die kleine Wohnung peinlich ist, öffnet diese einen Wandschrank und findet dort eine Terrasse. Diese wird zu einem Ort des Träumens, an dem sie sich all die Geschichten erzählen, die mit mehr Geld hätten möglich sein können. Die Kollegin wird zum Teil der Familie – aber nur, weil sie es ist, die die Terrasse erschaffen kann, deren Gegebensein vorausgesetzt, aber nie besprochen wird. Als die Kollegin, Stephanie, die Tür zur Terrasse schließt, reißt sie damit die Familie auseinander.
Ein heterosexuelles Paar lebt mit seinem Baby in einer zu kleinen Wohnung und leidet unter Armut und Enge. Als sie eine Kollegin einladen, vor der ihnen die kleine Wohnung peinlich ist, öffnet diese einen Wandschrank und findet dort eine Terrasse. Diese wird zu einem Ort des Träumens, an dem sie sich all die Geschichten erzählen, die mit mehr Geld hätten möglich sein können. Die Kollegin wird zum Teil der Familie – aber nur, weil sie es ist, die die Terrasse erschaffen kann, deren Gegebensein vorausgesetzt, aber nie besprochen wird. Als die Kollegin, Stephanie, die Tür zur Terrasse schließt, reißt sie damit die Familie auseinander.
Dieser erste Teil des Buches hat mich fasziniert. Die Idee des rätselhaften Ortes, die Angst, diesen wieder zu verlieren, und Annies Einsamkeit, als ihre Tochter und ihr Mann verschwunden sind – all das hat mich sehr berührt und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht: „Aber für einen kurzen Moment bemerkte Annie an den Rändern ihrer Stimme ein echte Traurigkeit und versuchte ausfindig zu machen, was für einen leeren Raum diese Ränder umschlossen und womit er sich füllen wollte.“
Im zweiten Teil fällt der Text in eine andere Welt: Ich lese die Geschichte eines Königspaars und eines weiteren Paars, das mit der Geburt des Kindes den Zusammenhalt verliert: „auch eine Familie ist ein Ökosystem, das aussterben kann“. Während ich das herrlich queere und absurde Märchen genossen habe, konnte ich mit der Geschichte um das dritte Paar wenig anfangen: zerfallende Dialoge, eine Absurdität nach der anderen und das Einzige, was ich zu verstehen glaubte, war, dass es auch hier darum geht, wie Einsamkeit nicht überwunden werden kann und eine dritte Person eine Beziehung zum Zerbrechen bringt, weil sie die nicht überwindbare Sehnsucht sichtbar macht. Es geht um Verlust und die Angst vor dem Verlust, die diesen vorwegnimmt.
Auch wenn der Text durchweg von großer sprachlicher Schönheit ist, hätte ich ihn hier abgebrochen, wenn mir nicht eine andere Person gesagt hätte, dass das Ganze noch Sinn ergibt, wenn ich durchhalte. Mir war dieser mittlere Abschnitt zu absurd, zu verquast, zu unverständlich, er zog sich in die Länge und verärgerte mich in seiner Unzugänglichkeit.
Achtung: Spoiler. Auch wenn ich mich um Vagheit bemühe, sollte, wer nichts über den weiteren Verlauf des Textes lesen möchte, nach der übernächsten Leerzeile weiterlesen. Stephanie, die Freundin, die den Wandschrank öffnet, konnte schon als Kind Räume erschaffen. Es sind Räume für ihre Sehnsüchte, wobei unklar ist, warum sie von klein auf so umfassende unerfüllte Sehnsüchte hat. Als Stephanies Schwester bei einem Unfall stirbt, geben die Eltern Stephanie und ihrer rätselhaften Fähigkeit die Schuld daran. Spätestens ab diesem Zeitpunkt fällt Stephanie in einen Kokon aus Einsamkeit, dem sie auch in Folge nicht entrinnen kann. Mir scheint, dass diese Einsamkeit der Raum ist, der gefüllt werden soll. Sie ist immer das merkwürdige Mädchen, und wenn sie es wagt, anderen ihre Fähigkeit zu zeigen, gerät sie immer wieder an Will: einen Mann, der sie ausnutzen möchte. Aufrecht gehalten wird sie von der Vorstellung, dass ihre Schwester irgendwo noch lebt, dass es ein Universum mit dieser Schwester gibt, der einzigen Person, der sie sich verbunden fühlen kann. Und es ist genau dieses Universum, das sich auf der anderen Seite der Terrasse befindet. Nur kann Stephanie hier Räume nur schrumpfen lassen, was sie auf der anderen Seite hinzufügt, fehlt hier.
Der vierte Teil des Romans spielt auf einer Raumstation, in der eine Rosie einer Frau begegnet. Das könnten Personen sein, die in anderen Teilen bereits eine Rolle gespielt haben (Rosie und Annie?), müssen es aber nicht. Rosie lebt in einer lesbischen Beziehung und sehnt sich nach ihrer getrennten Frau. Mit der kryptischen Besucherin ergibt sich eine (für Rosie nicht erklärliche) Verbundenheit.
Der Weltenbau bleibt für mich zum Großteil kryptisch, wichtig scheint mir, dass Menschen hier allein leben müssen, nur mit ihren eigenen Erinnerungen. Ob sie auch einsam sein müssen, stellt Rosie in Frage. Hier wird erklärt, dass es die Möglichkeit gibt, durch die Zeit und den Raum zu reisen, zu springen. Stephanie bleibt also nicht mehr ein Einzelfall. Trotzdem endet der Text, ohne etwas zu erklären.
Meines Erachtens behandelt der Text zwei wesentliche Themen: Die Frage nach Einsamkeit und der Möglichkeit von Verbindung zwischen Menschen und die Frage danach, ob man etwas gewinnen kann, ohne anderswo etwas zu nehmen: „Wozu jemanden mögen, wenn sie jederzeit verschwinden kann?“ Nebenbei wird auch die Frage aufgemacht, was eigentlich real ist: „Dies ist einer der letzten schönen Tage, an die Anne sich erinnern kann, und wenn uns nur noch unser Gedächtnis bleibt, wenn alles gesagt und getan ist, könnte sich all dies genauso gut ganz zum Schluss ereignet haben.“ Mir scheint, dass Leichter alle Geschichten zu einem bittersüßen Bild verwebt, in der jede Beziehung mit einem Verlust endet. Das ist einerseits schön und berührend, andererseits blieb es mir zu kryptisch und depressiv. Auch wenn die geschilderten Personen detailliert ausgedacht sind, bleiben sie mir fern und fremd, ein facettenreiches Bild der Einsamkeit, das ich stellenweise zäh zu lesen fand. Ich weiß aber, dass es anderen Lesenden in meiner Umgebung anders ging und die Figuren für sie sehr plastisch und berührend wurden.
Fazit: Das Buch ist rätselhaft und an vielen Stellen nur als Metapher zu verstehen. Meines Erachtens hat es besonders im zweiten Teil große Längen. Ein Bonus sind auf jeden Fall die sprachliche Schönheit und die originelle Herangehensweise. Wer experimentelle, schwebende Texte mag, wird hier Freude haben.
Unterhaltung: 1,5 von 3
Sprache/Stil: 3 von 3
Spannung: 1,5 von 3
Charaktere/Beziehungen: 2 von 3
Originalität: 2 von 3
Tiefe der Thematik: 2,5 von 3
Weltenbau: 1 von 3
Gesamt: 12,5 von 21
