Ursula K. Le Guin: Am Anfang war der Beutel. Warum uns Fortschritts-Utopien an den Rand des Abgrunds führten und wie Denken in Rundungen die Grundlage für gutes Leben schafft. ThinkOya
mindblowing
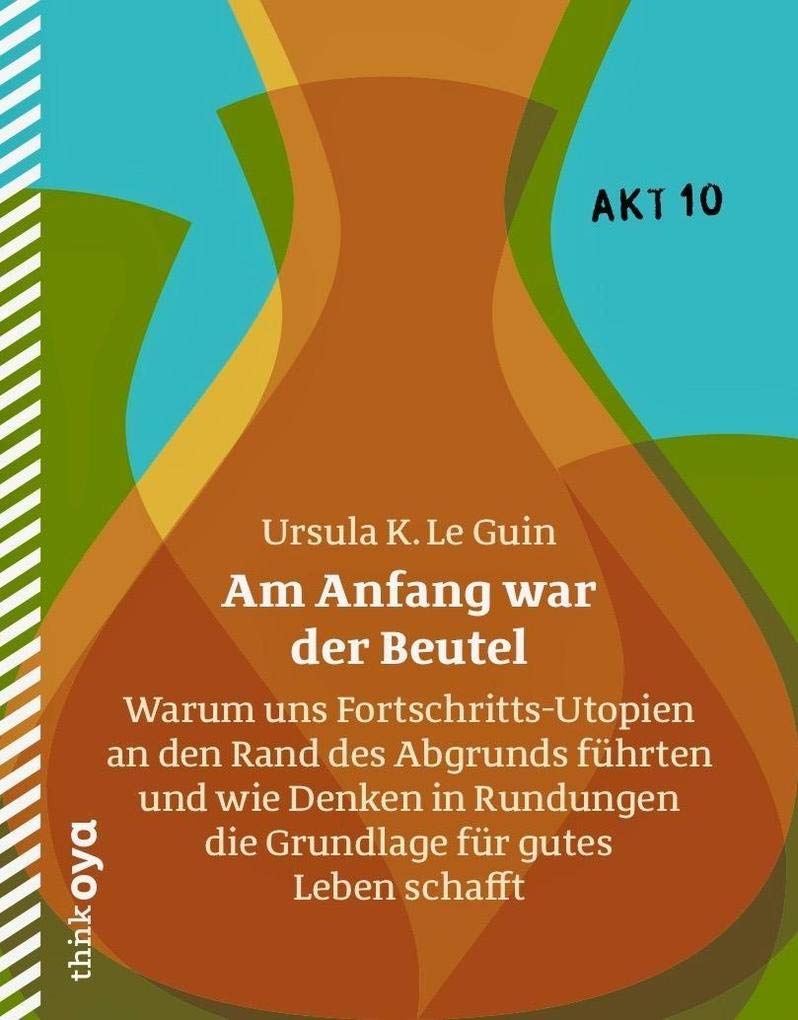
Das schmale handliche Büchlein vereinigt sechs Essays und ein Gedicht der berühmten feministischen Autorin. Teilweise handelt es sich um gehaltene Vorträge. Bereits der Untertitel des Büchleins macht klar, dass Le Guin hier politisch wird: Es geht ihr nicht nur um phantastisches Schreiben, sondern um einen anderen Blick auf unser jetziges Leben – und die Frage, wie dieses verbessert werden kann. Le Guin verzaubert dabei mit ihrer eindringlichen, dichten Sprache und bekommt es hin, nur schwer Fassbares in Worte zu fassen. Kein Wunder, dass ich vieles an diesen Texten nur inuitiv aufnehmen konnte.
Ich möchte in dieser Rezension nicht versuchen, den Inhalt der Essays wiederzugeben, dazu sind diese zu dicht und zu verschieden. Außerdem müsste ich dazu wie Le Guin schreiben können und das ist mir leider nicht gegeben. Im Folgenden lasse ich euch daher an einigen Gedanken teilhaben, die ich bemerkenswert fand oder die mir beim Lesen durch den Kopf gingen.
Le Guin stellt dar, dass es zwei verschiedene Sichtweisen auf Wissenschaft gibt: Der Idee von exakter Naturwissenschaft steht Wissenschaft als Prozess gegenüber, ein Prozess, in dem es keine Gewissheiten gibt und in dem das Wissen von heute morgen überholt oder widerlegt sein kann. Le Guin regt dazu an, Geradlinigkeit loszulassen, um Geschichten zu erzählen – Geschichten über Fürsorge und Reproduktionsarbeit.
Geschichten werden nicht im luftleeren Raum geschrieben und Le Guin fragt sich, was die Verwertungslogik von Texten mit uns Schreibenden macht. Welchen Einfluss hat die Gesellschaft, in der die Texte geschrieben werden? Und wie kann man (queer)feministisch schreiben? Ich finde mich in Le Guins Aussage sehr wieder, dass wir meist nicht für Profit schreiben, sondern dass es eine lebendige Fantasietätigkeit ist, der wir uns hingeben – und die nebenbei noch verwertbar ist.
Geschichten sind sehr wirkmächtig, sie definieren, wer wir sind und wie wir uns sehen. Le Guin fragt danach, ob wir Held*innen brauchen und wenn ja, wofür, und ob sich wohl heldenhafte Geschichten über das Sammeln von Dingen oder die Erziehung von Kindern erzählen lassen. Ich mag es, wie sie meint, es sei nicht leicht – aber wer wolle schon, dass Schreiben leicht sei? Le Guin wählt den Beutel als Gegensymbol zum Schwert, den Beutel als vermutlich erste menschliche Erfindung, um Gesammeltes und Kinder zu transportieren. Sie malt das Bild von Menschen, die nur aus Langeweile auf die Jagd gingen – weil sich daraus bessere Geschichten erzählen ließen. So wurde der Alltag der sammelnden und sorgenden Menschen schnell unsichtbar. Menschen, so stellt Le Guin heraus, können kaum je etwas allein schaffen. Sollte sich dies nicht auch in Geschichten niederschlagen?
In „Utopying, Utopyang“ beschäftigt sich Le Guin mit Utopien und der Frage, wie es möglich sei, wirklich anders zu denken als wir heute leben. Sie plädiert dafür, die jetzige Gesellschaft genau zu beobachten – und sich dann um die Überwindung von Denkgrenzen zu bemühen. Unkontrollierbarkeit sieht sie dabei nicht als zu überwinden an, sondern als hohes Gut, das uns den Weg zu einem besseren Leben weisen kann. Le Guin schaut sich verschiedene Mythen an und taucht in Schöpfungsmythen amerikanischer Indigener ein – Denkweisen, die mir so fremd sind, dass ich den Text wohl noch mehrfach lesen muss, um ihn wirklich aufnehmen zu können.
Fazit: Letztlich liefert diese Essaysammlung zahlreiche Anregungen und zwar sowohl für das Schreiben utopischer Texte, als auch für politische Arbeit. Ein reichhaltiger Schatz, ein Beutel voller Anregungen und freundlicher Verstörungen, den ich gern weiterempfehle.
Meine Kategorien lassen ich hier weg, einfach weil sie unpassend sind. Stellt euch stattdessen einfach einen prall gefüllten Beutel vor. ;)
