Shawna Potter: Making Spaces Safer: A Guide to Giving Harassment the Boot Wherever you Work, Play and Gather. AK-Press
Pragmatisch und liebevoll
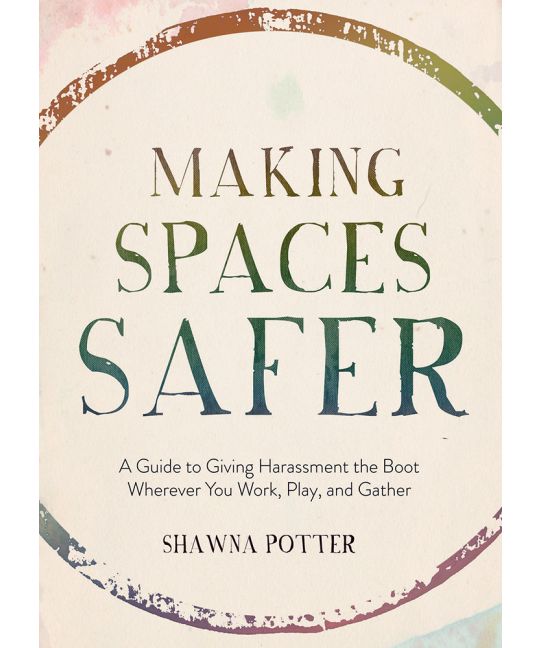 Shawna Potter, Band-Frontperson von „War on Women“ aus Baltimore, arbeitet seit über zehn Jahren daran, Gemeinschaften lebendiger und sicherer für alle zu machen. Sie gibt dazu Seminare und hat mit diesem Buch ihre Erfahrungen und Anregungen für alle zugänglich gemacht. Das Buch ist auf englisch über https://www.akpress.org/making-spaces-safer-book.html erhältlich, es gibt außerdem eine sehr erschwingliche Kurzversion. Potter lädt explizit dazu ein, die Inhalte bekannter zu machen und zu teilen, daher werde ich in dieser Rezension auch versuche die inhaltlichen Hauptpunkte des Buches wiederzugeben.
Shawna Potter, Band-Frontperson von „War on Women“ aus Baltimore, arbeitet seit über zehn Jahren daran, Gemeinschaften lebendiger und sicherer für alle zu machen. Sie gibt dazu Seminare und hat mit diesem Buch ihre Erfahrungen und Anregungen für alle zugänglich gemacht. Das Buch ist auf englisch über https://www.akpress.org/making-spaces-safer-book.html erhältlich, es gibt außerdem eine sehr erschwingliche Kurzversion. Potter lädt explizit dazu ein, die Inhalte bekannter zu machen und zu teilen, daher werde ich in dieser Rezension auch versuche die inhaltlichen Hauptpunkte des Buches wiederzugeben.
Potter schreibt in einer leicht lesbaren und inklusiven Sprache; allgemein angesprochene Personen werden entgendert mit they benannt, PoC und Personen mit Behinderungen explizit mitgedacht.
Das Buch beginnt mit einer Einladung und Erklärung, warum es sinnvoll ist, sich um einen Safer Space zu bemühen, egal ob mensch eine Bäckerei, einen Club oder einen anderen Ort, an dem sich Menschen versammeln, betreibt. Dies sei gute Werbung und wir alle wollen, dass sich unsere Gäst*innen oder Kund*innen wohlfühlen. Es gebe zwar keine rundum sicheren Orte und das könne auch niemand erreichen, aber danach zu streben sei für alle besser.
Was mich an dem Buch am meisten beeindruckt, ist, dass es einerseits klar ist, welches Verhalten nicht geduldet wird, dass der Text aber andererseits von einer tiefen Liebe für alle Menschen getragen ist, auch für die, die gerade andere kränken oder verletzen. Eine derartige Haltung, in der jeder Person ein Recht auf Veränderung zugestanden wird, erlebe ich selten.
Potter stellt dar, wie beschämend es ist, öffentlich belästigt oder angegriffen zu werden. Das Gefühl, dass Zusehende es dulden, wenn ich schlecht behandelt werde, macht die Belästigung sehr viel schwerwiegender. Um das zu ändern, kann jede Person beitragen.
Im Lesen fiel mir auf, dass das englische Wort „harassment“ sich nicht gut übersetzen lässt, beinhaltet es doch nicht nur Belästigungen, sondern auch Bedrohungen, Drangsalierungen und beunruhigendes Verhalten. Wie all diese Dinge verhindert und wenn sie geschehen, gut aufgefangen werden können, ist Inhalt des Buches.
safe-space-policy
Potter regt dazu an, als Veranstaltungsort eine safe-space-policy zu entwickeln und Hinweise auf diese deutlich sichtbar zu machen: als Poster an den Wänden, auf Veranstaltungseinladungen, auf der Webseite. Damit werden einerseits Besucher*innen informiert, welches Verhalten geduldet wird und welches nicht, andererseits können so für Opfer Personen benannt werden, an die sie sich wenden können. Natürlich müssen alle Mitarbeiter*inne mitziehen, es braucht also Vorbereitungsprozesse, Austausch und Sensibilisierung. Sich als Team auszutauschen und in Rollenspielen Reaktionen zu üben, braucht viel Zeit. Aber auch als Einzelperson mit diesem Anliegen kann eine Veränderung bewirkt werden.
Reaktion auf Belästigungen
Im zweiten Kapitel beschäftigt Potter sich mit der Reaktion auf Belästigungen. Diese sollte opferzentriert sein, aber auch Täter*innen nicht beschämen. Als Mitarbeiter*in des Ortes ist es wichtig, sich dem Opfer zuzuwenden, der Person einen sicheren Ort anzubieten („möchten Sie vielleicht mit mir dort drüben sitzen?“), am besten einen, an dem niemand zusieht, und Angebote zu machen, die der Person das Gefühl der Kontrolle über die Situation zurückgeben. Wichtig sei es, transparent anzusagen, wie mensch mit der Situation umgehen möchte (bleibe ich bei der Person oder gehe ich kurz weg? Muss ich Fragen stellen?) und dann Optionen anzubieten, wie weiter damit umgegangen werden kann. Diese Optionen müssen vorher erarbeitet werden: ein Auge auf die Täter-Person haben, mit ihr sprechen, sie rauswerfen.
Es sollte darauf geachtet werden, wer die beste Person ist, um einem Opfer beizustehen: Kann die Person mich als sicher erleben? Oder ist jemand anders geeigneter? Dann ist es gut, an diese Person abzugeben. Wichtig ist, dass das Opfer nicht vergessen wird, während mensch sich um die Täterperson kümmert. Ggf. kann angeboten werden, das Opfer zur nächsten Bahnstation oder zum Auto zu begleiten.
Wichtig sei, dem Opfer zuzuhören und es ggf. zu beruhigen. Dazu bietet Potter eine Liste von Beruhigungstechniken an, wie gemeinsam ruhig atmen, fünf Dinge aufzählen, die die Person sieht, hört, spürt u.a. Wichtig ist, dass das Opfer wütend sein darf und den Veranstalter*innen nicht verzeihen muss.
Beim Sprechen mit der Person, die eine andere belästigt hat, ist es gut, auf das Verhalten zu rekurrieren und es als mögliches Versehen zu labeln. Außerdem können Hinweise gegeben werden, wie dieses Verhalten (konkret benennen) nicht mehr vorkommt. Potter benennt die Wichtigkeit, immer gleich zu handeln, egal ob die Person bekannt ist oder nicht. Wenn die Regel ist, dass eine Person, die Andere gegen ihren Willen anfasst, diese eine Veranstaltung verlassen muss, dann gilt das auch für eigene Freund*innen.
Für den Alltag hilfreich sind die „fünf Ds der Zuschauer*innen-Intervention“.
1. Direkt: direkt benennen, was passiert und das dass nicht okay ist: „Lass die Person in Ruhe!“ oder auch „Das ist unangemessen“. Diese Reaktion geht nur, wenn ich selbst und das Opfer sicher sind und nicht mit Eskalation zu rechnen ist.
2. Distract: Ablenken. Mensch kann entweder mit der Täterperson oder dem Opfer über etwas völlig Anderes sprechen, nach dem Weg fragen, so tun als würde mensch sich kennen usw. Mensch kann den eigenen Kaffee verschütten und so für Ablenkungen und Aufregung sorgen oder „versehentlich“ körperlich zwischen Täter und Opfer geraten.
3. Delegieren: Eine Person ansprechen, die helfen kann oder (wenn das passend erscheint) die Polizei oder einen Sicherheitsdienst informieren.
4. Delayed: Verzögert reagieren. Besonders, wenn die Handlung sehr schnell ging, hilft es dem Opfer, es danach anzusprechen und zu fragen, wie es ihm*ihr geht, zu sagen, dass ich das beobachtet habe und es mir leid tut, dass das passiert ist. Ggf. kann Unterstützung angeboten werden – eine Weile dableiben, Anzeige erstatten …
5. Dokumentieren: Besonders wenn jemand anders sich schon kümmert, kann es hilfreich sein, die Sache aufzunehmen, am besten so, dass auch Straßenschilder oder ähnliche Landmarken zu sehen sind. Was mit dem Video geschieht, sollte danach immer mit dem Opfer abgesprochen werden.
Kein Opfer ist sich oder anderen eine Reaktion schuldig. Obwohl täglich Personen belästigt oder beschimpft werden, fühlen Opfer sich oft allein. Es ist völlig in Ordnung, wegzugehen oder die Situation zu ignorieren, für das eigene Gefühl kann es aber besser sein, sich Pauschalentgegnungen zurechtzulegen, die auf viele Situationen passen. Eine Belästigung rechtfertigt jedoch nicht, die andere Person zu entwerten oder aufgrund eines Merkmals zu diskriminieren.
Entschuldigungen
Wenn am eigenen Ort jemand schlecht behandelt wurde, ist es wichtig, sich richtig zu entschuldigen.
- ggf. zuerst knapp „Es tut mir leid. Ich denke darüber nach und melde mich, wenn ich mich beruhigt habe“
- meinen Fehler benennen, Verantwortung dafür übernehmen und sagen, dass es mir leid tut
- genau sagen, wie ich Wiederholung vermeiden möchte
- ggf. Wiedergutmachung anbieten („wenn es irgendetwas gibt, das ich tun kann“) – das wird wahrscheinlich als Einzelperson nie passen oder zutreffen
- Ziel ist nicht Vergebung, sondern Heilung (und Lernen meinerseits)
- es geht um die Personen, die verletzt wurde, nicht um mich (also nicht „deine Schmerz tut mir leid“ oder „achjeminee wie sehr tut es mir leid, dass ….“, meinen Schmerz darüber nicht zu groß machen)
Flirten
Bei Workshops werde Potter besonders von heterosexuellen cis Männern gefragt, wie gutes Flirten gehe. Ganz einfach: Bekunde dein Interesse an einer Person knapp und ohne auf ihr Äußeres einzugehen. Schau dann, welche Signale kommen, und nimm sie ernst. Wenn die Person Desinteresse signalisiert, geh weg. Wenn sie Interesse ausdrückt, beginne ein Gespräch. Fertig.
Internet
Potter geht leider nur kurz auf das Internet und dortige Räume ein. In sozialen Medien werde nach Outcalls fehlerhaften Verhaltens meist die Person, die den Fehler gemacht hat, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Das sei aber kein guter Umgang. Die Leute um die Person herum, die den Fehler gemacht hat, sollten helfen, zu lernen und sich zu verändern. Dann sollte die Person eine nächste Chance bekommen.
alternative Gerechtigkeit
Potter beschäftigt sich ausführlich mit alternativer Gerechtigkeit und der Frage, wie jenseits von Strafen und Ausschluss mit Fehlverhalten umgegangen werden kann. Sie benennt dies explizit als Gemeinschaftsleistung und benennt auch Beispiele, wie sie als Gemeinschaft eine Person angesprochen haben, von der sie fürchteten, sie würde Drinks mit Drogen versetzen. Um zu lernen, andere fair und freundlich zu behandeln, brauche eine Person Unterstützung und Rückhalt und im besten Falle kann eine Gemeinschaft dies nicht nur dem Opfer, sondern auch der Täterperson bieten. Die Kapitel hierzu sind nochmal auf ganz andere Weise augenöffnend, geht es hier doch nicht darum, Personen, die sich unerwünscht verhalten, auszugrenzen und an den Pranger zu stellen. Potter stellt ernsthaft die Frage, wie solche Personen das eigene Verhalten ändern und weiter integriert bleiben können.
Im ausführlichen Anhang enthält des Buch jede Menge Beispieldokumente, wie Regeln für Safer Spaces aussehen können, welche Art von Ankündigungen dazu gemacht werden können usw.
Fazit
Insgesamt ist es Shawna Potter meines Erachtens gelungen, das Thema „sichere Räume“ umfassend und praxisnah zu beleuchten. Sie zeigt auch, dass eine wirkliche Verantwortungsübernahme sehr viel Beschäftigung mit dem Thema, mit eigenen Privilegien und potenziellen Vorfällen am eigenen Ort braucht. Sie ermutigt dazu, diesen Schritt zu wagen und betont dabei immer wieder die eigene Handlungsfähigkeit, auch wenn mensch vielleicht gefühlt gar nicht viel tun kann. Daher würde ich das Buch allen empfehlen, die … nein: einfach allen!
