Judith Vogt, Lena Richter, Heike Knopp-Sullivan (Hrsg.): Queer*Welten 12 / 12-24. Amrûn
in den Essays liegt die Stärke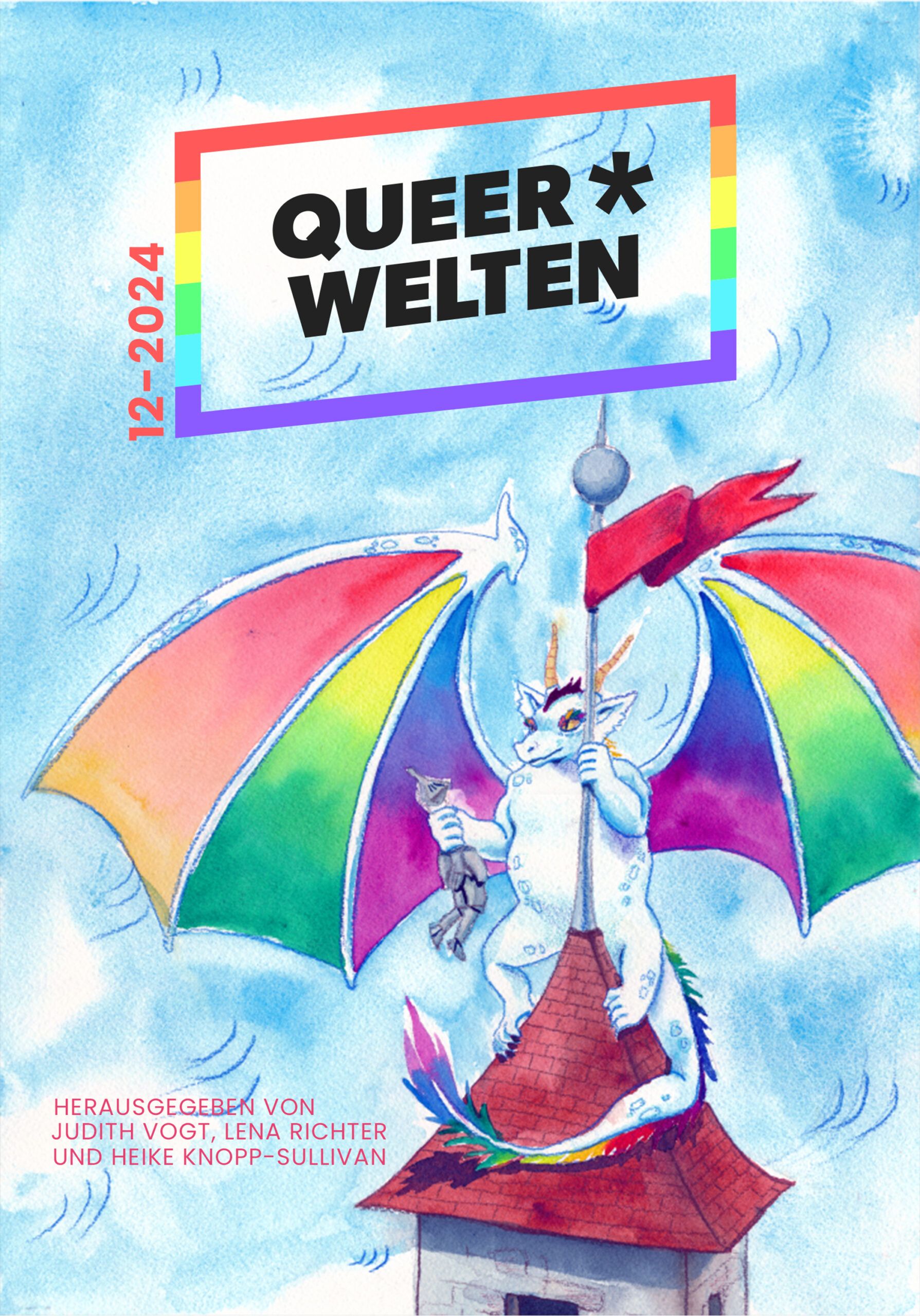
Vorwort
Das Vorwort beschäftigt sich diesmal mit Genre-Preisen und der eigenen Nominierung für den Kurd Laßwitz Preis. Sowohl das Heft als Ganzes als auch einzelne Geschichten wurden nominiert, was schön und vielleicht auch gleichzeitig schwierig ist. Dem gehen die Herausgebenden nach.
Queere Questen
Wie in den letzten Heften gab es auch für dieses eine Sonderausschreibung: Queere Questen in 600 Zeichen. Die Kurztexte sind in mehreren Blöcken über das gesamte Heft verteilt, ich werde sie hier kurz gemeinsam und blockweise besprechen.
"Anderssohn" von T. B. Persson ist sprachlich schön aber für mich inhaltlich etwas zu vage, "Die Herrin des Sees" (Liane Raposa) war gut lesbar, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Vermutlich ist eine genauere Kenntnis der Artussage nötig (nicht, dass ich ohne meinen Testleser gewusst hätte, wie die heißt). "Doch ... lieber" (Rebecca Reiter) mochte ich sehr und habe über das Spiel mit bekannten Märchenelementen geschmunzelt.
„Mimic“ von Ariadne Geiling ist eine niedliche Geschichte über das Finden eines etwas anderen Schatzes und hat einen witzigen Twist. „Wir sind Minotaurus“ (C. F. Srebalus) erzählt die Sage um den Ariadne-Faden als Polykül, auch hier habe ich das Gefühl, die Sage nicht gut genug zu kennen, um das wirklich zu verstehen.
„Als in Hornburg die Monarchie abgeschafft wurde“ (Kián KoWananga) zeigt eine kleine Szene, die durch Redebeiträge der „Mitgemeinten“ transformiert wird. Das ist einerseits witzig, andererseits klingt es für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr, als seien trans Personen die besseren Menschen, was mir unangenehm aufstößt. „Sternenschauer“ (Mila Münchow) erzählt eine kurze Episode aus der Sicht eines Roboters, der gern küssen will. Damit konnte ich wenig anfangen, die Gleichsetzung von Küssen mit Lebendigkeit hat mich geärgert. Die SF-Geschichte „Was Ritter tun“ (Emma Hogner) dagegen fing mich gut ein. Hier geht es um Trauer und die Hoffnung, den Geliebten zu finden.
„Aber …“ (An Brenach) bezieht sich auf eine bekannte Geschichte, die ich nur an den Namen erahnen kann. Offenbar unterhalten sich ein Mann und eine Frau, die meinen, einander heiraten zu müssen, aber beide homosexuell sind. Die Lösung ist ganz witzig. „Queere Quiche“ (Marie Meier) ist die Abwandlung eines Rezepts, bei dem Heldin, Drachin und Schwert einmal anders kombiniert werden. Auch „Die Wette“ (Christina Seeberger) wandelt bekannte Märchenelemente ab, ein Held wird hinters Licht geführt. „Zielvorstellung“ (Maike Frie) ist das Fragment einer Unterhaltung. Auch hier entscheidet sich die Heldin für Liebe statt Kampf. Da ich das nun schon mehrfach in diesem Heft gelesen habe, entlockt es mir nur noch ein Schulterzucken.
Das geht mir leider auch bei den folgenden beiden Questen so: "Drachenherz" (Phillip-C. Kasten) ist mir zu vorhersagbar, "Wo die Schatten drohen" (Nicole Hobusch) verstehe ich nicht. Ohne den tag „Verrat“ wäre ich nicht einmal auf die Idee gekommen, dass da noch eine Ebene sein muss, die mir entgeht.
„Nur ein kleiner Pieks“ (Britta Redweik) hätte mich mehr amüsiert, wenn da nicht diese unangenehme Doppeldeutigkeit der Überschrift, die auch gleichzeitig letzter Satz ist, wäre. Denn ich lese das als einen Verweis auf den Mythos vom Jungfernhäutchen, und den mag ich einfach nicht mehr hören/lesen. Die Idee, dass eine asexuelle Heldin ihre Jungfräulichkeit zur Geldquelle macht, gefällt mir aber gut. Stefan Mesch hat in „12 vital Stages“ das Leben einer queeren Person als ironische Queste dargestellt. Schmerzhaft, aber auf den Punkt gebracht und sprachlich sehr dicht. Das hat mich ziemlich begeistert!
„Erweckung“ von Iris Leander Villiam ist einer dieser Texte, denen ich auch bei mehrfachem Lesen nichts abgewinnen kann. Ich denke, dass ich eine Ebene der geschilderten Szene nicht verstehe, so erscheint sie mir zu belanglos. Auch „Naglfari Testoquest“ von Alex verstehe ich nicht, hier liegt das wahrscheinlich daran, dass ich mich mit nordischen Sagen nicht auskenne.
Rebecca Westkott: Der späte Wurm (Kurzgeschichte)
Der Einstieg in diesen Text bereitete mir Schwierigkeiten. Als sich die erste Szene als Simulation erwies, fiel ich völlig aus dem Text, auch weil mir nicht klar wurde, was diese Szene innerhalb des Weltenbaus soll. Weitergelesen habe ich, weil ich den humorvollen Ton mochte.
Inhaltlich geht es um eine Gruppe von Menschen, die auf einem Schiff eine weltweite Katastrophe überlebt und dort eine utopische Parallelgesellschaft aufbaut. Der Text ist randvoll mit kleinen Informationen zum Weltenbau und plätschert sehr langsam dahin. Ich empfand das als gut gemachten slice of live, fand aber einige der gezeigten Dinge so unglaubwürdig, dass ich das mehr und mehr als liebevollen Klamauk las. Mich hat das gut unterhalten, aber ich finde es wesentlich interessanter zu schauen, wie so eine Welt wirklich funktionieren würde. In diesem Text läuft alles völlig konfliktfrei, sich widersprechende Bedürfnisse werden gleichermaßen ernstgenommen. Das ist einerseits toll, andererseits aber eben auch zu utopisch, um glaubwürdig zu sein. Wie das gezeigte System sich selbst erhält, bleibt für mich unklar. Insgesamt ein unterhaltsamer Text; aus den tollen Ideen hätte man aber, so denke ich, mehr machen können.
Hollarius: Ma jada (Kurzgeschichte)
Ich mag den Schreibstil und die Einführung der Figuren, auch gelingt es, Spannung aufzubauen. Aber dann erfahre ich nicht genug vom Weltenbau (eine Fantasywelt), um zu verstehen, wer da warum gegen wen kämpft. Allgemein mag ich Rachegeschichten nicht besonders gern, ich glaube einfach nicht daran, dass ein Mord durch einen weiteren Mord irgendwie weniger schlimm werden könnte. Die Verbündung der beiden Hauptfiguren bleibt insgesamt zu vage, um mich wirklich zu begeistern.
Nox Juvenell: Der Phönix (Gedicht)
Ein Wort wie „heteronormativ“ in ein Gedicht zu packen, finde ich schon gewagt. Für mich funktioniert das nur humorvoll, dieser Text liest sich aber, als nehme er sich sehr ernst. Auch wenn das rein handwerklich gut gemacht ist, wirkt es auf mich zu pädagogisch, um mich anzusprechen.
Kae Schwarz: Spargelernte (Kurzgeschichte)
Den Einstieg mochte ich: Bei einem Mordfall auf einem Spargelhof wird der Bezirksmagier hinzugerufen und soll aufklären. Es wird gut beschrieben, was der Magier so alles tut, um den Fall zu lösen, und was er dabei findet. Allerdings nimmt das Tempo der Geschichte ab und spätestens ab dem Punkt, an dem er die Hexen besucht, ist mir alles zu sehr erklärt, so dass das Lesetempo zäh wird. Ich habe das Gefühl, die Message wird mir überdeutlich vermittelt, und das mag ich nicht. Zudem bleiben für mich alle Figuren zu blass: Gut und böse sind eindeutig verteilt, und die Auflösung des Falls kommt wenig überraschend, so dass im Kern ein stereotypischer Krimi erzählt wird.
Ich lese das als Urban Fantasy und aufgrund der Diskriminierung passt der Text für mich auch in die Queer*Welten. Aber insgesamt fehlt mir die Tiefe.
Yvonne Tunnat: Eis auf Raten (Kurzgeschichte)
Hier hatte ich mit dem Einstieg Mühe, weil er mir seltsam unorganisch vorkam. Die genau gesetzten Bilder faszinieren mich, aber ich musste mehrfach zurücklesen, weil ich nicht verstand, wer wer ist. Leider half mehrfaches Lesen hier nicht. Als ich dann weiterlas, löste sich die Frage aber nicht nur auf, sondern ich bekam einen richtig genialen Text geboten.
Die Überschrift legte eine falsche Fährte, denn sie erzeugte in mir Bilder von Eiskugeln und Geburtstagsparty. Aber hier geht es um einen Zwillingsbruder, der an einem Tumor erkrankt und eingefroren wird, damit Nanobots ihn über Jahre hinweg reparieren können. Nur leider dauert das sehr lange, und so erbt die Hauptfigur den eigenen Kryobruder samt immenser Kosten. Die Person muss nun entscheiden, wie sie damit umgeht.
Ich liebe es, wie die Beziehungen sensibel und mit Zwischentönen gezeichnet sind, wie jedes Wort sorgfältig gesetzt ist und sich im Hintergrund ethische Fragen und Probleme auffalten. Auch das recht offene Ende passt.
Kleines Manko ist für mich der holprige Einstieg, da machen sich meiner Meinung nach einige Bilder und Worte zu wichtig, sodass der Textfluss darunter leidet. Alles in allem kommt der Text aber eindeutig auf meine 2024er Favoritenliste.
Jamie-Lee Campbell: Warum rennt JAMES BOND nackt in einer Welt voller BetonPENISSE herum? In sieben Schritten zur Testosteron-Ekstase (Essay)
„Satirischer Essay“ ist eine Bezeichnung, die mir so noch nicht untergekommen ist, kommt doch der Essay an sich meist eher spitzzüngig und ernst daher. Campbell dagegen leitet uns hier zu einer paradoxen Intervention an: Was ist, wenn wir die Kritik an zu unmännlichen, zu unnormativen Texten ernst nähmen und alles, was nicht in eine ordentliche cis-het-männliche Welt passt, streichen? Die Autorin macht es vor und arbeitet mit Durchgestrichenem, Großschreibung und experimenteller Formatierung, um zu verdeutlichen, wie einengend Dogmen sein können. Ich habe mich köstlich amüsiert und dabei noch einige Denkanstöße bekommen.
Lars Schmeink: Die Repräsentation von „(Dis)ability“ in der Progressiven Phantastik (Essay)
Kenntnis- und zitatereich beschäftigt sich der Autor mit problematischen Darstellungen von als abweichend gelabelten Körpern in der Phantastik. Dabei geht es nicht nur im funktional-medizinische Aspekte, sondern um verschiedene Aspekte des Ausschlusses bestimmter Körperlichkeiten aus öffentlichen Räumen. Das werde ich sicher noch mehrfach lesen, weist der Essay doch darauf hin, dass (Dis)ability eben nicht nur ein individuelles, sondern vor allem ein gesellschaftliches Phänomen ist. Anhand von Beispielen benennt Schmeink gelungene und weniger gelungene Texte.
Queertalsbericht
Wie immer endet das Heft mit Ankündigungen für Veranstaltungen und Rezensionen von Romanen und Sachbüchern. Diesmal kenne ich die meisten mich interessierenden Bücher schon.
Fazit: Wie immer bietet die Queer*Welten interessante Einblicke, wobei die Stärke dieser Ausgabe für mich klar bei den Essays liegt. Als Kurzgeschichte hat mich „Eis auf Raten“ begeistert, die Queeren Questen zeigten mir, dass ich mir bei so kurzen Texten mehr sprachliche Finesse wünsche. Insgesamt wirkten die Abwandlungen von Märchen auf mich irgendwann fast schematisch, oft wünschte ich mir, die Geschichten würden wirklich erzählt, statt nur angedeutet, was bei der Kürze der Texte natürlich nicht geht. Da es aufgrund der Auswahl einige thematische Doppelungen gab, wäre hier für mich weniger mehr gewesen.
Aufmachung 2 von 3
Unterhaltung 2 von 3
Textauswahl 1,5 von 3
Originalität 2 von 3
Diversität 3 von 3
Tiefe 1,5 von 3
Gesamtfazit: 12 von 18 möglichen Punkten
