Ursula K. Le Guin: Immer nach Hause. Carcosa
überbordend, widersprüchlich, viel
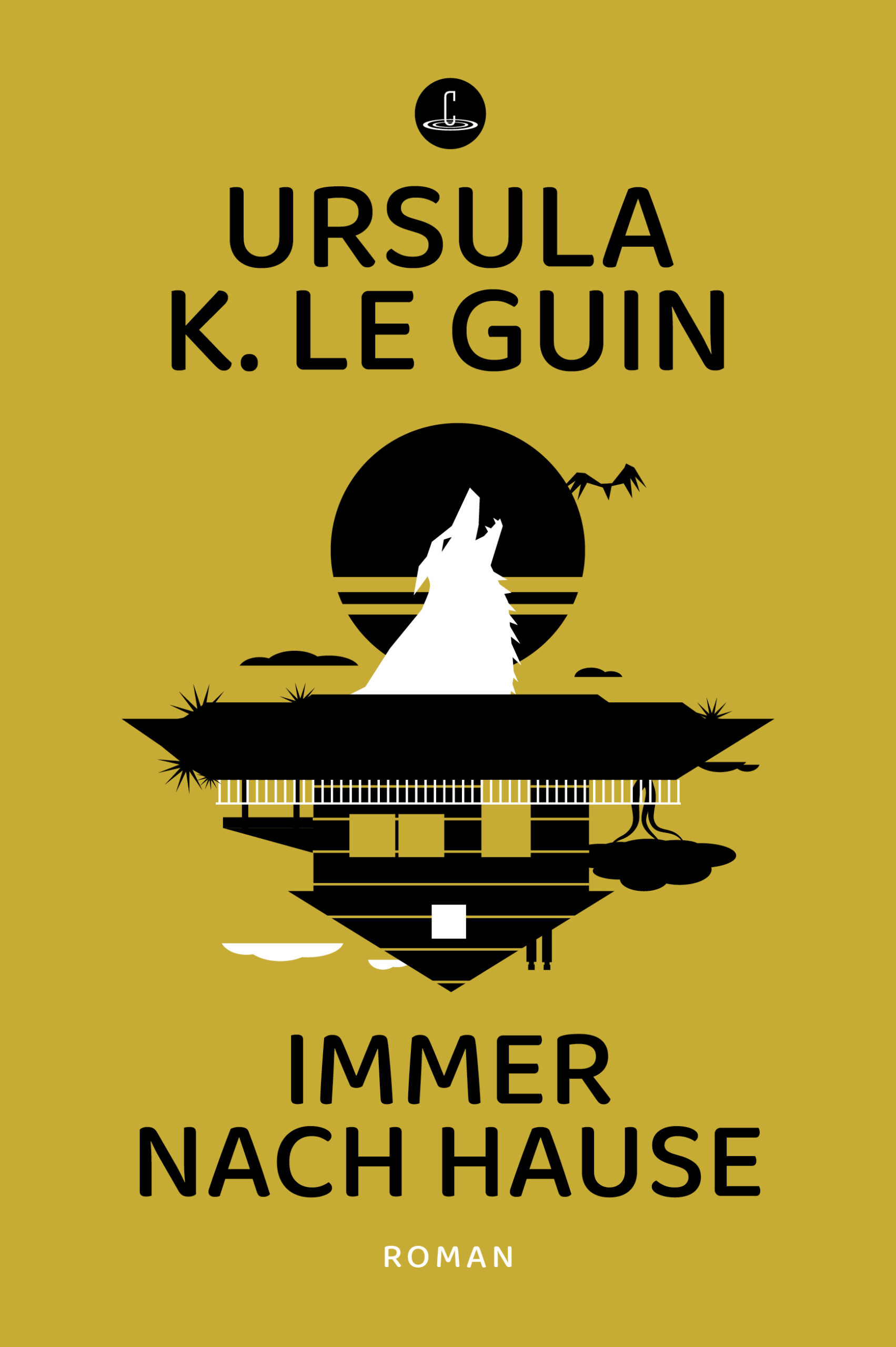 850 Seiten umfasst dieser Wälzer, der definitiv nicht reisetauglich ist. Kein Wunder, dass dies meine längste Rezension wird. Die Grundidee dieses Buches gefällt mir: Le Guin tut so, als sei sie Archäologin und untersuche eine Kultur, die es erst in der Zukunft geben wird: die der Kesh. Aus Funden und Erzählungen, Überlieferungen und Ausgrabungen setzt sie die Kultur zusammen, mit beeindruckender Akribie und viel Wohlwollen für das Fremde.
850 Seiten umfasst dieser Wälzer, der definitiv nicht reisetauglich ist. Kein Wunder, dass dies meine längste Rezension wird. Die Grundidee dieses Buches gefällt mir: Le Guin tut so, als sei sie Archäologin und untersuche eine Kultur, die es erst in der Zukunft geben wird: die der Kesh. Aus Funden und Erzählungen, Überlieferungen und Ausgrabungen setzt sie die Kultur zusammen, mit beeindruckender Akribie und viel Wohlwollen für das Fremde.
Bei genauerer Betrachtung wächst in mir aber doch die Frage, warum die Autorin sich diese Einschränkung auferlegt hat, denn aus dem Ausgraben von Hinterlassenschaften lässt sich vieles nicht ablesen. Insbesondere wenn die Kultur, wie Le Guin beschreibt, sehr suffizient und nachhaltig gelebt hat, bleiben die Bauten und Instrumente unklar, werden sie doch verrottet sein.
Auf dem Cover von „Immer nach Hause“ steht „Roman“, aber schon beim Durchblättern des Buches wird deutlich, dass sich das Buch nicht in eine solche formale Kategorie einordnen lässt. Die Textsammlung beginnt mit einer konzeptuellen Einführung, dann folgt ein Lied(text), dann der erste Teil der Geschichte einer Person namens Erzählstein. Es handelt sich um einen slice of live Bericht einer zunächst zum großen Teil unverständlichen fiktiven Kultur, ein Bericht, von dem unklar ist, wie er archäologisch zu finden sein könnte. Le Guin sprengt hier also gleich am Anfang die selbst auferlegten Grenzen. Trotz Le Guins schöner Sprache zieht sich der Bericht dann doch ganz schön in die Länge, zumal ich einen Spannungsbogen vergeblich suchte.
Inhaltlich geht es um ein Kind, das ausgeschlossen und gehänselt wird, weil es anders ist. Im Laufe des Textes wird deutlich, dass das Andere der abwesende Vater ist, der aus einer anderen Region stammt. Hier geht es also um Rassismus, von dem das Kind betroffen ist. Die wenig sensiblen Erziehungspersonen beschützen es weder, noch beantworten sie die Fragen des Kindes. So ist es einsam und allein gelassen und kann sich seine Herkunft erst ein Stück weit erschließen, als nach neun Jahren der unbekannte Vater plötzlich in der Tür steht. Er ist Soldat und das Mädchen folgt ihm ein wenig in seine Welt, jedoch ohne dass sich ein Erwachsener die Mühe macht, seine zahlreichen Fragen zu beantworten. Wieder wird es alleingelassen und nun schwebt noch die Gefahr eines Krieges am Horizont – da war ich schon einigermaßen erstaunt. Denn das alles sind Dinge, die für mich gewiss nicht zu einer Utopie gehören. Für wen ist also das Leben der Kesh eine Utopie, wenn schon ein Kind mit einem fremden Vater ausgeschlossen wird?
Nach der Erzählung von Erzählstein geht es weiter mit einer Darstellung der verschiedenen Subgruppen und Spiritualität der Kesh, manches aus der Erzählstein-Erzählung kann nun eingeordnet werden. Es folgen mehrere kurze Geschichten, wie sie bei den Kesh mündlich überliefert wurden, diese sind kurzweilig, aber nicht immer ganz verständlich. Oft folgen sie keinem klassischen Spannungsbogen und den Hauptfiguren wird übel mitgespielt. Gleichzeitig gibt es hier aber erstmals Zugewandtheit und Freundschaft, was ich in der ersten längeren Erzählung schmerzlich vermisst habe. Hier entwickelt sich bei mir beim Lesen auch die Freude darüber, die Kultur zu entdecken, ich kann die vielen kleinen Details und die in die Tiefe ausgedachten Denkweisen schätzen und entdecken.
Die folgenden Gedichte und Schmähsprüche dagegen bereiteten mir wenig Freude, sind sie doch, wie manche der vorigen Geschichten auch, von zotigen Witzen rund um Penisse und deren Größen bestimmt, die ich in ihrer toxischen Maskulinität (und der wohl witzig sein sollenden Entwertung dieser) und der begleitenden Heteronormativität alles andere als utopisch fand. Hinzu kommt die Entwertung von Personen geringer Intelligenz und die (spielerische) Entwertung von Leuten aus dem Nachbarort. Natürlich muss es auch in utopischen Gesellschaften Zynismus, Frotzeleien und Gebalge geben. Aber muss das immer auf Kosten derselben Personengruppen geschehen?
Es folgen Abzählreime, fröhliche kleine Gedichte und ein Liebeslied, die mich wenig berühren.
Um Begräbnis- und Sterberituale geht es im folgenden Abschnitt. Der erste Teil ist eine Schilderung aus der Sicht eines Kesh, der nächste aus der Sicht der Anthropologin. Auch hier sind Lieder enthalten, die in bestimmten Phasen des Sterbens und Trauerns gesungen werden, und diese empfinde ich als berührend und tröstlich. Es wird deutlich, wie die Gemeinschaft das Sterben trägt und wie jede Phase von Melodien und Worten begleitet wird. Gewundert habe ich mich darüber, dass Tote verbrannt werden, ist das doch eine energetisch sehr verschwenderische Variante der Bestattung, die nicht recht zum Grundkonzept des Buches passt.
Die Vorstellungen rund um Seelen und Wiedergeburt werden locker benannt, sie erscheinen nicht als gefestigte Lehre, sondern als nebeneinanderstehende und teilweise widersprüchliche Vorstellungen, was ich als sehr angenehm und frei empfinde.
Die folgenden kurzen Texte sind der Einführung zufolge „Amouren“, was keine Liebesgeschichten, sondern Texte über Verfehlungen sind. In der ersten geht es um eine inzestuöse Vergewaltigung und den folgenden Suizid des Täters, in der zweiten um eine Person, die sich auf eine verbotene Reise begibt, auch hier kommt es zu inzestuösem Sex. In der dritten opfert sich ein Mann für seine Frau, ohne dass ich den Sinn dahinter verstehen könnte. Die vierte Geschichte handelt von einer Frau, die im Wald einem ausgestoßenen Mann begegnet und mit ihm eine sehr vorsichtige Freundschaft entwickelt. Hier ist für mich keine Verfehlung erkennbar. In dem Text kommt eine trans Frau vor, beschrieben als „Mann, der als Frau lebte“, allerdings wird sie bei jeder Erwähnung misgendert.
Für mich muss eine Utopie, um ihrem Namen gerecht zu werden, die schwierigen Themen unserer Zeit (und aller Zeiten) zumindest ansatzweise lösen. Das sind neben dem Leben über unsere Kosten und der Frage der Vermeidung von Kriegen auch die Vermeidung von systematischer Diskriminierung und Kriminalität. Auch der Umgang mit Krankheit und Leid spielt eine wichtige Rolle.
Die „Amouren“ handeln von solchen Themen, aber sie bieten mir keine hilfreichen Ansätze. Im Gegenteil: Vergewaltigungen sind offenbar auch bei den Kesh ein beliebtes Narrativ, ebenso wie die Idee von (psychischer) Krankheit als Strafe oder Grund für die Ausstoßung von Menschen, die dann als „wahnsinnig“ oder „verwildert“ diskreditiert werden.
Der Sammlung von Gedichten ist die Erklärung vorangestellt, dass bei den Kesh Dinge der Person gehören, die sie erfunden oder angefertigt hat. Die Leute aber gehören zum Land oder zum Haus – nicht andersherum. Reichtum besteht darin, etwas verschenken zu können und so sind die Gedichte alle Geschenke. Viele Texte handeln von Vergänglichkeit, Tod und Sterben, manche davon fand ich berührend.
Die „Vier Historien“ sind mündlich erzählte Geschichten, die erste heißt „Alte hasserfüllte Frauen“ und handelt von zwei Großmüttern, die einander hassen, obwohl sie ein Haus teilen. Ihr Hass aufeinander wird an die Kinder und Enkel weitergegeben, so dass diese sich das Leben schwer machen, statt sich gemeinsam um das Haus zu kümmern. Die Geschichte endet tragisch und findet erst eine Lösung, als Personen von außerhalb das Leid wahrnehmen und Verantwortung für Veränderung übernehmen. In mir bleibt die Frage offen, warum erst mehrere Personen sterben müssen, bis jemand genau hinsieht und handelt.
Auch in „Ein Krieg gegen die Schweineleute“ geht es um Verantwortung: Es wird von (bis auf eine Ausnahme männlichen) Jugendlichen erzählt, die beschließen, Krieg miteinander zu führen. Wie sie das angehen, erscheint naiv, trotzdem sterben dabei mehrere Personen. In einer nachgestellten Erklärung von Klar, einer anderen beteiligten überlebenden Person, wird deutlich, dass bei den Kesh Jugendlichen zugestanden wird, das eigene Leben für Unsinn zu opfern, und dass Klar sich schämt, weil er eigentlich zu alt dafür gewesen sei. Mich berührt diese Ansicht tief, die Frage danach, ob ich meinem Kind die Freiheit geben würde, sich ermorden zu lassen. Klar interpretiert diese Freiheit als Freiheit zum Suizid: „wobei sie entscheiden dürfen, ihr Leben wegzuwerfen, wenn sie kein ganzes Leben bis ins hohe Alter auf sich zu nehmen wünschen. Das ist ihre Entscheidung. Wer es auf sich nimmt, ein ganzes Leben zu leben, (…) besitzt nicht mehr das Vorrecht der Jugend.“ Es gibt also bei den Kesh eine Altersspanne, in der Suizid als Möglichkeit offensteht, danach gibt es aber eine Verpflichtung, weiterzuleben. Klar schämt sich, dieser nicht nachgekommen zu sein und nur durch Glück überlebt zu haben.
„Die Ortschaft Chumo“ erzählt von einer abgebrannten Ortschaft und deren Wiederaufbau, lässt mich dabei aber ziemlich ratlos zurück. Die kurze Erzählung wirkt eher wie ein Fragment. Anders „Probleme mit den Baumwollleuten“: Hier erfahre ich recht ausführlich von der Unzufriedenheit mit der Nichteinhaltung einer alten Handelsvereinbarung und wie sich vier Männer auf den Weg machen, um die weit entfernt lebenden Handelspartner zu besuchen. Im Text ist gelungen Weltenbau eingeflochten, das Nebeneinander von modern anmutenden Dingen wie Eisenbahnen und mit Solarstrom betriebenen Webstühlen und mittelalterlich anmutenden Strapazen wie der Reise in einem Segelboot oder zu Fuß, weil keine Verkehrsmittel vorhanden sind. Interessant ist auch die Verhandlung, die die Probleme nicht benennt und trotzdem einen Weg findet, den alten Handel zu erneuern ohne die Personen, die die Vereinbarung gebrochen haben, zu beschämen. Die Verfehlung wird nicht einmal benannt, aber trotzdem ausgeräumt, was mich sehr beeindruckt hat. In diesen „Historien“ scheint für mich erstmals das Utopische dieses Buches auf, die Art wie im Glauben an Verantwortung des Einzelnen und gleichzeitiger Fürsorge füreinander Probleme angegangen und gelöst werden, wie sie aber auch verhandelt werden können, wenn eine Lösung nicht möglich ist.
Der Abschnitt des Buches endet mit einem kurzen Text zu Pandora, der mich berührt, ohne dass ich ihn fassen könnte.
„Stadt und Zeit“ ist wieder ein größerer Abschnitt des Buches und nun weitet sich allmählich das Bild von der Welt der Kesh. Denn nun erfahren wir, dass die „Börse“, die in der letzten Geschichte für Kommunikation genutzt wurde, ein Internetterminal ist. Zumindest interpretiere ich es so, dass es eine KI gibt, die aus vielleicht ehemals menschlichen Bewusstseinen besteht und die an diesen Börsen mit den Menschen interagiert, wenn diese es wünschen. Sie stellt Informationen zur Verfügung ohne diese auszuwählen oder zu bewerten und fragt gelegentlich auch Dinge an. So ist den Kesh unser heutiges Wissen und noch viel mehr frei zugänglich – und einige verschreiben ihr Leben dem Studium von Wissensgebieten. In zwei kryptischen Geschichten erfährt man etwas über die heutige Welt und wie die Kesh über sie denken. Interessant für mich war die Unterstellung von Absicht: „Aus ihrer Sicht handeln Menschen nicht versehentlich. Menschen hatten Unfälle, aber dafür, was sie taten, waren sie selbst verantwortlich.“ So schreiben die Kesh uns auch Verantwortung für die Ausrottung von Spezies’ zu.
Allerdings habe ich mit dem Rest dieses Abschnitts zunehmend Schwierigkeiten, denn es wird deutlich, dass die Kesh das bereitgestellte Wissen so anders nutzen, dass kaum Verständigung entsteht. In „Anfänge“ schauen wir einer (gänzlich blass bleibenden) forschenden Person über die Schulter, die eher aus unserer Welt kommt und versucht, etwas über die Geschichte des Tals herauszufinden. Da die Kesh ein sehr anderes Verständnis von Chronologie haben, wird die forschende Person zunehmend frustiert – allerdings, so muss ich leider zugeben: ich beim Lesen auch. Ich war in diesem Textabschnitt abwechselnd verwirrt und gelangweilt und wusste nicht recht, was ich damit anfangen soll. Man kann das zum Thema passend genial oder verfehlt finden … ich kann mich nicht recht für eines entscheiden.
„Erzählstein. Zweiter Teil“ ist nun für mich leichter verständlich, weil ich dank der Zwischentexte mehr von der Welt weiß. Ich interpretiere nun den ersten Teil auch anders, als Erzählung über ein einsames Kind, das mit einem psychisch kranken Großvater aufwächst und Außenseiter ist, weil der Vater nicht aus dem Tal stammt. Eule, wie Erzählstein damals heißt, sucht allein nach einem Platz im Dorf, lernt zu schlachten und zu töpfern, aber Eule kann nirgendwo ankommen, auch weil sie mit niemandem über ihr Leid sprechen kann. Die Stimmung zu Hause ist von Streit geprägt und niemand im Ort scheint sich dafür verantwortlich zu fühlen, dass da ein Kind leidet.
Als Eules Vater vom Kondorvolk wieder auftaucht, entschließt sie sich, mit ihm zu gehen. Niemand sagt ihr, was sie erwartet, und so geht sie naiv mit dem Vater mit, der, wie sich zeigt, zu einem Soldatentrupp gehört, der plündernd nach Hause zieht. Eule redet sich die Plünderungen schön, weil sie nicht sehen will, wohin sie geraten ist, und ist nur vor Übergriffen geschützt, weil ihr Vater der General ist. Sie lernt die fremde Sprache und erhält einen neuen Namen: Ayatru.
Auch in dem neuen Zuhause ist Ayatru eine Ausgestoßene. Obwohl ihr Vater es hinbekommt, dass sie nicht in den Status einer Sklavin gerät, was eigentlich der Fall wäre, weil ihre Mutter aus einem anderen Volk stammt, wird sie nicht akzeptiert. Frauen haben bei den Kondorleuten, zu denen der Vater gehört, keine eigenen Rechte; sie dürfen die Häuser nicht verlassen und sind nur mit häuslichen Tätigkeiten beschäftigt. Le Guin verbindet das mit einer monotheistischen Religion, von der Herrschaft abgeleitet ist. Ayatru ist nur damit beschäftigt, zu gehorchen. Eine Sklavin bedient sie und zeigt ihr, was nötig ist, und sie erfährt, dass sie bald verheiratet werden soll.
Trotzdem versteht sie fast nichts, weil die Kulturen so verschieden sind, dass sie auch hier stets eine Fremde bleibt. So haben die Kesh ein völlig anderes Verständnis von Hierarchie, die stets nur für kurze Zeit entsteht, wenn eine Person eine Funktion übernimmt, die sie dann wieder abgibt, während das Leben bei den Kondorleuten von beständigen Hierarchien und Machtmissbrauch geprägt ist. Ayatru versteht nicht, was Heirat in diesem Volk bedeutet, und sehnt sich nach der alten Freiheit, sich allein draußen zu bewegen und zu tun, was ihr richtig erscheint. Eine Chance, sich zu wehren, scheint sie auch hier nicht zu haben.
Es ist eine traurige, langsam erzählte Geschichte, die mich sehr berührt, so spannend, dass ich mich zurückhalten muss, um den nächsten Teil nicht direkt nachzulesen.
Die folgenden Theaterstücke der Kesh geben noch etwas Unterfütterung der Geschichte von Erzählstein. Das erste Stück „Der Hochzeitsabend in Chukulmas“ handelt von einer (Gruppen)Hochzeit, in der plötzlich ein überzähliges Paar auftaucht, das auch verheiratet werden möchte. Es sind zwei Geister von Personen, die vor Jahrzehnten bei einer tragischen Liebesgeschichte gestorben sind. Das Stück endet damit, dass ihnen erlaubt wird zu heiraten, auch wenn die Folgen unklar bleiben … und ist so ein Gegenentwurf zur hierarchischen Welt des Kondorvolkes. Auch die folgenden Stücke sind Gegenentwürfe, die zeigen, wie die Kesh zwar Sexismus kennen und leben, es neben den Vorstellungen, wer wie zu sein habe, aber auch immer Möglichkeiten der Gestaltung und des Ausbruchs gibt. Die Theaterstücke zeigen Werte und Moralvorstellungen, spielen aber auch mit diesen oder brechen sie.
Einer ziemlich kryptischen Erzählung von Pandora über Wildheit folgt die Beschreibung des Mondtanzes. Dieser ist eine riesige Gruppensexorgie, die über mehrere Tage geht und bei der Kinder und alte Frauen ausgeschlossen werden. Le Guin beschreibt ausführlich, dass sich alle Frauen ihr entziehen können, bestätigt aber das Bild des Mannes, der immer Sex will. Wie im ganzen Buch stößt es mich etwas ab, dass häufig das Wort „ficken“ verwendet wird, Sex scheint etwas Ordinäres, Grobes zu sein. Transmenschen kommen auch hier explizit vor, werden aber als „Männer, die als Frauen leben“ bezeichnet und somit misgendert. Sie können teilnehmen, aber nur wenn sie Sex mit dem anderen Geschlecht wollen. Welches Geschlecht Le Guin hier meint, bleibt ebenso unerwähnt wie die Frage, was mit Männern ist, die nicht mitmachen wollen, und was mit Menschen, die keinem Geschlecht oder einem anderen als männlich und weiblich angehören. Und was ist mit Homosexuellen? Erwähnt wird, dass Frauen die während des Mondtanzes empfangenen Kinder meist abtreiben, da diese als vaterlos gelten. Manche Frauen wollten aber auch genau das.
Es folgt eine Sammlung von Gedichten, diesmal oft mit melancholischem Ton und acht „Lebenserzählungen“, biografische Erzählungen, teilweise mit fiktivem Gehalt. Darunter ist ein kurzer Text eines Mädchens, dass sehr beeindruckt ist, als es das erste Mal einen Zug sieht, die Geschichte eines Mannes, der auf der Suche nach Wahrheit mehrere suizidale Handlungen begeht und eine Art Prosagedicht über jemanden, der sich immer unerwünscht fühlt und sich unsozial verhält. In einem anderen Text geht es um Krankheit und Pflege, in wieder einem um eine Person, die Visionen (oder eine Wahnerkrankung) hat: Flirre aus Serpentin. Flirre erzählt recht ausführlich, wie sie als Kind das erste mal Halluzinationen hat und sich nicht mit ihrer Familie verbunden fühlt. Der Text ist eine sensible Schilderung einer psychotischen Erkrankung und Flirre findet die Hilfe, die sie braucht, und einen sehr ruhigen und wenig fordernden Lebensort, den sie auch wieder verlassen kann, als sie es möchte. Mich berührt es sehr, wie sie als Elektrikerin arbeitet und ihren Sehnsüchten nachhängt. Nebenbei handelt die Geschichte auch von Geschlechtsrollenstereotypen und dem Leiden daran, ihnen nicht zu genügen. Trotzdem finden die benannten Personen Möglichkeiten, ihre den Erwartungen nicht genügenden Vorstellungen auszuleben.
Interessant ist, dass hier Spätfolgen unseres Lebens benannt werden: Nebenbei erfährt man, dass jedes vierte Kind tot oder schwer behindert geboren wird und dass überlassene Umweltgifte zu schweren Krankheiten führen.
Die kurzen Texte aus dem Tal sind philosophisch und für mich zum großen Teil nur teilweise und assoziativ verständlich. Das Gespräch zwischen Pandora und der Archivarin der Bibliothek der Madronenhütte dagegen habe ich wirklich genossen, führt es doch spitzzüngig und pointiert einige gängige Lügen, die wir uns immer wieder erzählen, ad absurdum. So geht es beispielsweise um die Frage, ob es nicht besser sei, Bücher wegzuwerfen, als Wissen zu sammeln, das aufgrund hoher Zugangsvoraussetzungen (Zeit und Anwendungswissen) nur einer Elite zugänglich ist und daher Machtungleichheit vermehrt.
Es folgt ein Kapitel aus dem Roman „Gefährliche Leute“, in dem es um eine verschwundene Frau geht. Die Art der Erzählung, die immer wieder anderen Personen folgt, nachdem diese sich begegnet sind, finde ich von der Struktur her interessant. Inhaltlich langweilt mich der Text aber, weil er über weite Strecken scheinbar ziellos herummäandert.
Nach einem Pandora-Zwischenspiel geht es mit dem letzten Abschnitt der Erzählung von Erzählstein weiter. Achtung, hier werde ich spoilern! Wer das nicht will, lese nach der nächsten Leerzeile weiter. Ayatru lebt im Haus der Familie ihres Vaters und leidet dort so sehr, dass sie krank wird. Ihr Vater wird bald wieder in eine Schlacht weggeschickt und Ayatrus Sklavin ist ihre einzige Bezugsperson. Die Geschichte wird recht distanziert erzählt. Wir erfahren, wie Ayatru an einen natürlich älteren Mann verheiratet wird und dass sie den Sex mit ihm mag. Später wird quasi im Nebensatz erwähnt, wie er sie vergewaltigt und dass sie darum das entstandene Kind abgetrieben habe. Später entscheidet sie sich für eine Schwangerschaft und gebiert ein Mädchen. Die Wirtschaft in der Stadt wird immer mehr zur Kriegswirtschaft, alles wird dem Bau von Waffen untergeordnet, Armut und noch mehr Angst halten Einzug.
Ayatru entscheidet sich zur Flucht und wird dabei von ihrem Vater, der inzwischen in Ungnade gefallen ist und sich in seinem Haus versteckt, unterstützt. Gemeinsam mit der Sklavin und der Tochter gelingt die Flucht und Ayatru erreicht nach sieben Jahren der Abwesenheit das Tal irher Geburt. Ich finde es sehr berührend, wie sie dort wieder Anschluss findet und auch Schatte, die Sklavin, aufgenommen wird. Erstmals kann Ayatru, die zu Heimgekehrte wird, ihr Leben gestalten und die Erzählung endet mit dem Gefühl, dass sie doch noch so etwas wie Zufriedenheit gefunden hat.
In dieser Erzählung kommt im Nebensatz ein verheiratetes schwules Pärchen vor, ebenso wie Heimgekehrte lange mit einem Mann wohnt, bevor sie sich entscheidet, ihn zu heiraten, was er seit langem wünscht.
Der Erzählung sind Dokumente aus der Börse nachgestellt, die etwas darüber erzählen, wie die Leute im Tal und andere mit dem Kondorvolk umgehen. Daneben gibt es Erläuterungen der fiktiven Forscherin (der Autorin?), die darüber nachdenkt, warum das Kondorvolk sich selbst zerstört hat und ob das daran liege, dass es keine industrielle Wirtschaft gab, die so große Waffensysteme tragen konnte. Möglicherweise sei auch die kürzere Lebenserwartung und die große Anzahl behinderter Menschen ein Vorteil, der auf lange Sicht für mehr Frieden sorge.
Es folgt der Bericht eines Kesh über langwierige Beratungen zur Frage der Kriegerhütten. Ich lese es so, dass einige Kesh sich verteidigen wollten und dazu Soldaten wurden, dass aber andere fanden, dass schon das Soldatische ein Verlust sei und Kampf keine Lösung. Es endet damit, dass die Kriegerhütten sich auflösen. Mich hat dieser Teil des Buches sehr angeregt und berührt, weil er für mich eine tiefe Wahrheit enthält.
Es folgt wieder eine Sammlung von Gedichten, vor allem Kinder- und Lehrgedichte. Mich haben diese nicht wirklich angesprochen und ich habe sie zum Großteil überblättert.
Insgesamt ist für mich nun ein wenig die Luft raus: Die folgenden Schilderungen von Tieren, Verwandtschaftsbeziehungen, Kleidung, Essen (inklusive Rezepte) und Berufen sind zwar irgendwie interessant, aber mir fehlt ein spannunggebendes Element und letztlich langweile ich mich etwas. Geärgert habe ich mich über die Schilderungen homosexueller Paare und das Aufgreifen des Klischees, in diesen müsse jemand die „männliche“ und die „weibliche“ Rolle besetzen.
Es geht mit Schilderungen weiter: Musikinstrumente, ausführliche Beschreibungen zweier Feste und derer spiritueller Bedeutung (ich habe das Gefühl, dass die Kesh eigentlich ständig feiern, da die Tänze meist mehrere Tage dauern. Gleichzeitig ist es berührend, wie Leben und Tod, Trauer und Freude in der Gemeinschaft gehalten und geteilt werden), die Bahn, Anmerkungen zur Medizin und zu Spielen. Das Buch spielt ja ohnehin mit Fragen von Zivilisation und „Primitivität“, das wird hier in den Schilderungen von Medizin und der Bahn, die auf hölzernen Schienen fährt, noch einmal deutlich. Beide Bereiche lassen sich für mich gar nicht einordnen.
Die folgenden „generativen Metaphern“ sind anregend, über jede einzelne könnte ich lange nachdenken. Aber in der Masse sind sie mir dann doch zu viel. Interessant ist die Abhandlung über die Phase des „Lebens an der Küste“, in der Jugendliche ungefärbte Kleidung tragen: Sie sind nun keine Kinder mehr und auch keine Erwachsenen und werden dazu angehalten, sexuell enthaltsam zu leben. Für mich liest es sich, als läge eine große Freiheit darin selbst zu entscheiden, wann diese Phase verlassen wird und sich so der eigenen erwachenden Sexualität bewusst zu werden, ohne sie ausleben zu müssen. Es folgt eine Sammlung von Abhandlungen über das Schreiben und die Liebe und schließlich ein Wörterbuch der Kesh, immer wieder durchsetzt von Gedichten.
Der „Anhang“ genannte Teil des Buches beinhaltet Materialien, die Le Guin später entwickelt hat. Innerhalb der im Buch vertretenen Rahmengeschichte besucht Pandora nun also ein weiteres Mal die Kesh und bringt einen etwas erweiterten Ausschnitt von „Gefährliche Leute“ mit. Die bereits bekannten Teile des Textes interpretiere ich in diesem neuen Zusammenhang etwas anders, was sicher interessant ist, weil ja jede ethnologische Abhandlung oder Geschichte immer fragmentarisch bleibt. Nur: Rechtfertigt das, denselben Text zweimal abzudrucken?
Es folgen Kesh-Meditationen, einige Lieder der Bluthütte (die sich mit Menstruation und Geburt beschäftigen) und eine Abhandlung über die Syntax der Kesh-Sprache.
In „Mays Löwe“ erhalten wir einen Einblick, wie Le Guin versucht hat, die Kultur der Kesh zu entwickeln. Ausgehend von einer Geschichte um eine Farmerin, die einem Löwen begegnet, erzählt die Autorin eine Kesh-Version der Geschichte. Hier ist also zu sehen, wie sie aktiv verfremdet, einen Ansatz, den sie danach verworfen hat.
Der letzte Abschnitt des Buches enthält Essays der Autorin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gelungen finde, diese nach 749 Seiten dem Wälzer anzufügen, denn sie können gut für sich stehen. „Welten bauen“ stellt die These auf, dass wir in jedem Moment unseres Lebens die Welt bestätigen oder verändern, in der wir leben, und dass Autor*innen nur aus bekannten Welten schöpfen können.
„Ein nicht-euklidischer Blick auf Kalifornien als kalten Ort in spe“ ist bereits in „Am Anfang war der Beutel“ erschienen. Der Essay beschäftigt sich mit der Geschichte Kaliforniens und der Ausrottung der dortigen Indigenen – und der Frage, ob die meisten Utopien nicht von einer Gleichheit aller Menschen ausgehen, die letztlich zur Despotie führen muss.
„Die Tragetaschentheorie des Erzählens“ ist auf ebenfalls im o.g. Band erschienen und behandelt unseren Blick auf die ersten Menschen. Le Guin geht davon aus, dass das erste Ding, das ein Mensch anfertigte, ein Beutel gewesen sein müsse – und leitet daraus einen ganz anderen Blick auf frühe Menschen ab. „Text, Stille, Vortrag“ beschäftigt sich mit gesprochenen und geschriebenen Texten und der Frage, warum wir heute geschriebene Texte höher schätzen als gesprochene. Sie lädt dazu ein, Texte auch zu sprechen. Wahrscheinlich wäre sie vom Boom der Hörbücher nicht überrascht.
„Legenden für ein neues Land“ erzählt davon, wie Le Guin von den Ureinwohnern Amerikas beeinflusst war. Sie schreibt sensibel darüber, wie sie sich habe anregen lassen, ohne zu stehlen – gleichzeitig verwendet sie immer wieder den Begriff „Indianer“, was mich wundert. Ja, die Texte sind alt (später 1980er), aber gab es damals nicht auch schon Selbstbezeichnungen?
Interessant für mich ist, wie sie sich vom Land hat anregen lassen: Der Text spielt im heutigen Kalifornien im Napa-Tal. Tatsächlich kann ich mit dem Angeregtsein durch eine bestimmte Region und Landschaft viel anfangen.
Es folgt ein ausführliches Interview mit Le Guin, Todd Barton (Komponist) Margaret Chodos-Irvine (Illustratorin) und George Hersh (Geomant). Falls ihr euch fragt, was ein Geomant ist: Offenbar hat er dabei mitgeholfen, die Landkarten zu erstellen. Das Interview las sich amüsant und leicht und zeigt, wie die vier Personen zusammen an diesem Buch gearbeitet haben und wie Le Guin um Veröffentlichung rang. Es wurden sogar die Instrumente der Kesh nachgebaut. Ich habe mich gefragt, ob so eine Zusammenarbeit heute noch ginge und wie sie finanziert worden ist. Das Ringen um Einnahmen wird im Interview leider nur am Rande erwähnt.
Im letzten Text „indianische Onkel“ geht es um amerikanische Ureinwohner, die Le Guins Vater kannte, und die Le Guin teilweise kennengelernt hat. Der Text ist sehr berührend und macht deutlich, wie Le Guin als Kind Kulturunterschiede erlebt hat – und wie viel sie aus heutiger Sicht nicht verstanden hat. Auch, wie viel Wohlwollen es braucht, um einander trotzdem zu begegnen.
Am Ende des Buches findet sich ein Link zu der mit Todd Barton gemeinsam entwickelten Musik. Es wird auch Kesh gesprochen und man kann einige Lieder anhören, was ich natürlich getan habe. Ich fand das Ergebnis interessant, es erlaubt noch einmal ein ganz anderes Eintauchen in diese fiktive Kultur. Mir scheint allerdings, dass in den Titeln Syntheziserstücke zu hören sind und es sich nicht um Aufnahmen der nachgebauter Instrumente handelt.
Fazit: Le Guin hat in „Immer nach Hause“ auf 860 Seiten eine beeindruckende Utopie entwickelt, insofern, als dass sie eine auf Genügsamkeit und Demut basierende Kultur erschaffen hat, in der die Freiräume für individuelle Menschen ausreichend groß sind. Der Text stellt an vielen Stellen unser jetziges Denken infrage. Trotzdem ziehen sich einige Dinge, an denen wir auch jetzt leiden, durch, wie Heteronormativität und ein zwar immer wieder gebrochener aber doch vorhandener Sexismus und Biologismus. Auch wenn es sich um eine sehr ausgearbeitete und kleinteilige Sammlung handelt, vor der ich Hochachtung habe, weil alles bis ins Kleinste durchdacht ist, stellte für mich das Durcharbeiten des Buches über doch recht beträchtliche Strecken eine Fleißaufgabe dar. Einzelne Elemente haben mich fasziniert und bereichert, aber als Sammlung war es mir zu überbordend, zu viel, zu üppig. Zu viele Gedichte, zu viele Fragmente, zu viele Beschreibungen.
Es wäre sicher ein spannendes Experiment, in dieser Welt einen Text oder eine Textsammlung zu schreiben (schon wieder eine Idee für eine Anthologie), insgesamt merke ich aber, dass ich mir Welten lieber durch Geschichten und Handlungen erarbeite als durch fiktive anthropologische Texte. Pandora tritt zwar als fiktive Zusammenstellerin der Texte auf, bekommt aber keinerlei Kontur und taugt somit nicht als Identifikationsfigur.
Insgesamt zeigt sich, dass sich dieses Werk mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln schwer fassen lässt. Es ist wert, entdeckt zu werden, aber in den schnellen Alltag mit kurzen Zeitfenstern, den ich mit so vielen heutigen Menschen teile, passt es nicht recht hinein. Vielleicht liegt aber auch genau darin seine Größe.
Unterhaltung: 1 von 3
Sprache/Stil: 1,5 von 3
Spannung: 0,5 von 3
Charaktere/Beziehungen: 0,5 von 3
Originalität: 3 von 3
Tiefe der Thematik: 3 von 3
Weltenbau: 3 von 3
Gesamt: 12,5 von 21
