Ursula Poznanski: Scandor. Loewe
spannend, aber ohne Tiefe
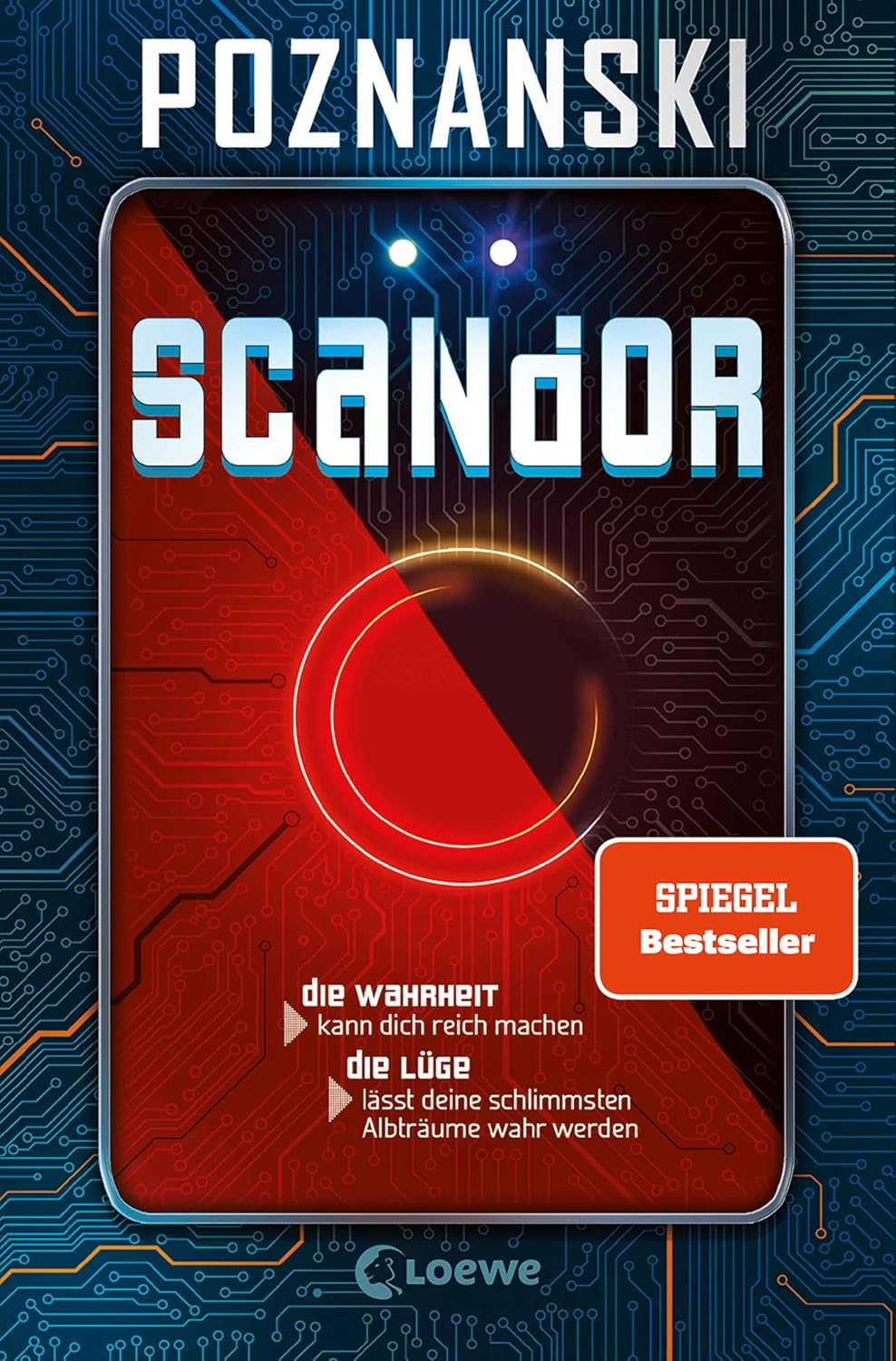 Stell dir vor, du könntest nicht mehr unerkannt lügen. Diese Grundidee beschäftigt mich seit Jahren, weshalb sie im Weltenbau von „Das Geflecht“ eine große Rolle spielt. Poznanski hat keinen neuen Sinn, sondern eine Maschine erfunden: den perfekten Lügendetektor. Einhundert Menschen sollen ihn um die Wette verwenden. Wer als längstes durchhält, gewinnt fünf Millionen Euro.
Stell dir vor, du könntest nicht mehr unerkannt lügen. Diese Grundidee beschäftigt mich seit Jahren, weshalb sie im Weltenbau von „Das Geflecht“ eine große Rolle spielt. Poznanski hat keinen neuen Sinn, sondern eine Maschine erfunden: den perfekten Lügendetektor. Einhundert Menschen sollen ihn um die Wette verwenden. Wer als längstes durchhält, gewinnt fünf Millionen Euro.
Ich finde Poznanskis Idee ziemlich genial. Was macht es mit unserem Alltag, wenn wir nicht mehr lügen können, wenn all die kleinen höflichen, unbedachten Aussagen wegfallen? Was macht es mit uns selbst, wenn wir uns ständig befragen müssen, ob das, was wir da von uns geben, wirklich authentisch ist? Ich denke, die Idee gibt Anlass zu jeder Menge ethischen, psychologischen und philosophischen Fragen, sowohl auf der Ebene der Träger*innen von Scandor, dem Lügendetektor, als auch auf der Ebene der Entwickler*innen. Wer sollte im Besitz der Maschine sein? Wer würde sie wohl wozu nutzen? Was hätte das für Einflüsse auf die Gesellschaft? Und wie müsste die Verwendung gesetzlich geregelt oder beschränkt werden?
Poznanski behandelt keine dieser Fragen wirklich. Stattdessen ist „Scandor“ ein Roman rund um ein Spiel. Denn die ausgewählten Menschen wollen alle gewinnen. Wenn nicht, müssen sie eine Sache tun, vor der sie sich sehr fürchten. Ich war zunächst erstaunt, wie belanglos diese „Strafen“ schienen, bis ich über meine eigenen Ängste nachdachte: Wenn, wie im Buch, alles, was mit Krankheit und Tod einhergeht, rausfällt, wenn die Dinge niemandem schaden dürfen, als mir selbst, kommt auch bei mir eine von außen recht belanglose Angst heraus. Und vielleicht lohnt sich schon für diese Erkenntnis die Lektüre des Buches.
Poznanski kann schreiben. „Scandor“ liest sich locker weg, es gibt kaum Formulierungen, die hervorstechen, weder positiv noch negativ. Auch Phrasen halten sich in Grenzen, mit der Ausnahme einiger kitschiger Beiwerke wie „wunde Herzen“. Gestolpert bin ich über die stark geschlechterbinäre Schreibweise und Ansprache: „Wir beginnen bei hundert und enden bei einem Sieger. Oder einer Siegerin.“ Nichtbinäre Personen kommen nicht vor, obwohl die Geschichte in der Jetztzeit spielt, wo wir es uns zumindest in Deutschland (noch?) leisten können, sichtbar zu sein. Und merkwürdigerweise gibt es zu Beginn des Buches einige Fehler bei den Zeitformen, wo plötzlich ein paar Sätze im Plusquamperfekt stehen, obwohl sie in der selben Zeit spielen wie die Erzählzeit.
Deutlich wird auch, dass die Autorin plotten kann: Auf mich wirkt der Roman von vorn bis hinten durchkonstruiert. Er hält die Spannung durchweg, man hetzt atemlos von der ersten bis zur letzten Seite, inklusive Kapitelcliffhanger und überraschender Wendungen. Natürlich bleibt es dabei nicht aus, dass einige Wendungen reichlich gewollt wirken. Leider trifft das für mich auch auf das Ende zu: Ja, es verknüpft gekonnt alle Fäden. Aber wenn ich über die Motivation hinter dem Ganzen nachdenke, wirkt es leider schon in der Grundanlage unglaubwürdig. Eben weil es die für mich so offensichtlich mit dem Thema verknüpften gesellschaftlichen Fragen gänzlich ausblendet. Und weil die (hier aus Spoilergründen nicht verratene) Motivation nur dadurch funktioniert, dass Poznanski die Veranstalter*innen so reich macht, dass sie einfach alles tun können und den Beschränkungen gewöhnlicher Menschen nicht unterliegen.
Beim Lesen folgen wir im wesentlichen zwei Erzählfiguren: Tessa, die die die (hihi) Teilnahme ermöglichende Münze von ihrem ungeliebten Onkel gestohlen hat und ihm eins auswischen will. Außerdem will sie ihren verarmten Eltern ein Haus kaufen. Und Philipp, der die Teilnahmemünze von einer jungen Frau bekommen hat, die er beeindrucken will, weil er in sie verschossen ist. Bei beiden erscheint mir die Motivation nicht stark genug, um sich dem Experiment zu unterziehen, aber um das im Buch beschriebene Spiel zu genießen, konnte ich das beiseite schieben. Während ich Tessa und Philipp durch das Buch folge, gibt es vor jedem Kapitel einen Countdown, bei dem die einhundert Kandidat*innen langsam weniger werden. Gelegentlich bekommen wir auch gezeigt, wie Leute ausscheiden, wobei Poznanski hier jegliche Ernsthaftigkeit vermeidet, wenn sie Dialoge und Szenen enden lässt, bevor es schwierig wird. Dafür geraten Tessa und Philipp in ein paar schwierige Situationen. Dass Tessa, die als Serviererin arbeitet, ihren Job verliert, als sie ehrlich ist, ist auch folgerichtig. Ich hätte mich allerdings gefreut, wenn der beschriebene Sexismus etwas eingehender thematisiert worden wäre und nicht nur als Problem, wenn frau ihn nicht weglächeln kann.
„Scandor“ ist ein Jugendbuch und ich denke, dass es als solches funktioniert. Es ist leicht lesbar, spannend, mit sympathischen Figuren, die allerdings nach der initialen Einführung wenig an Tiefe gewinnen. Es wird einfühlsam beschrieben, wie die beiden einander näherkommen (natürlich bekommen wir hier die ultimative cis hetero Lovestory mit Happy End serviert). Ich nehme es Poznanski allerdings übel, dass sie sich auf dem Liebesweg künstliche Hürden ausgedacht hat, die nicht wirklich zu den Figuren passen. Ebenso wie das Ende für meinen Geschmack unnötig kitschig gerät.
Am schwierigsten fand ich die Thematisierung zweier psychischer Erkrankungen. (Es gibt noch eine dritte, aber die ist nicht so schlecht thematisiert, und sie zu verraten, würde arg spoilern.) Da ist einerseits die Depression von Tessas Vater. Der Vater bleibt als Nebenfigur blass, die Depression wird so holzschnitthaft gezeichnet, dass Leid des Vaters mir nicht wirklich nahe kommt, ebenso wie, was es für Tessa bedeutet (hat).
Wer unter der zweiten Erkrankung leidet, möchte ich hier als Spoilergründen nicht verraten, daher vage: Zum Ende des Buches leidet eine Person an einem Beziehungswahn. Die Person stalked eine andere und wir bekommen einen Infodumpblock darüber serviert, dass eine Psychose der Grund dafür ist, einer der wenigen Infodumps im Buch. Leider hat sich Poznanski offenbar nicht die Mühe gemacht, gut zu recherchieren, und verbreitet so einige unschöne Klischees. So behauptet sie fälschlicherweise und falsch generalisiert, dass Psychosen nicht heilbar seien, und stellt Betroffene klischeehaft als gefährlich dar. Richtig ist, dass es vorkommt, dass unter Beziehungswahn leidende Personen die wahnhaft besetzte Person stalken. Richtig ist ebenso, dass es zum Krankheitsbild gehört, dass die falsche Wahrnehmung, mit der ersehnten Person in Beziehung zu sein, nicht korrigierbar ist. Es ist aber falsch, dass diese Psychose immer andauert oder dass sie generell nicht behandelbar ist.
Trotz dieser Schwächen fühlte ich mich gut unterhalten.
Fazit: „Scandor“ ist ein durchweg spannendes Buch mit sympathischen Figuren und einer interessanten Grundidee. Wer leichten Lesestoff sucht und Pageturner liebt, ist hier gut bedient.
Unterhaltung: 3 von 3
Sprache/Stil: 2,5 von 3
Spannung: 3 von 3
Charaktere/Beziehungen: 2 von 3
Originalität: 1,5 von 3
Tiefe der Thematik: 1,5 von 3
Weltenbau: 1 von 3
Gesamt: 14,5 von 21
