Ursula K. Le Guin: Immer nach Hause. Carcosa
überbordend, widersprüchlich, viel
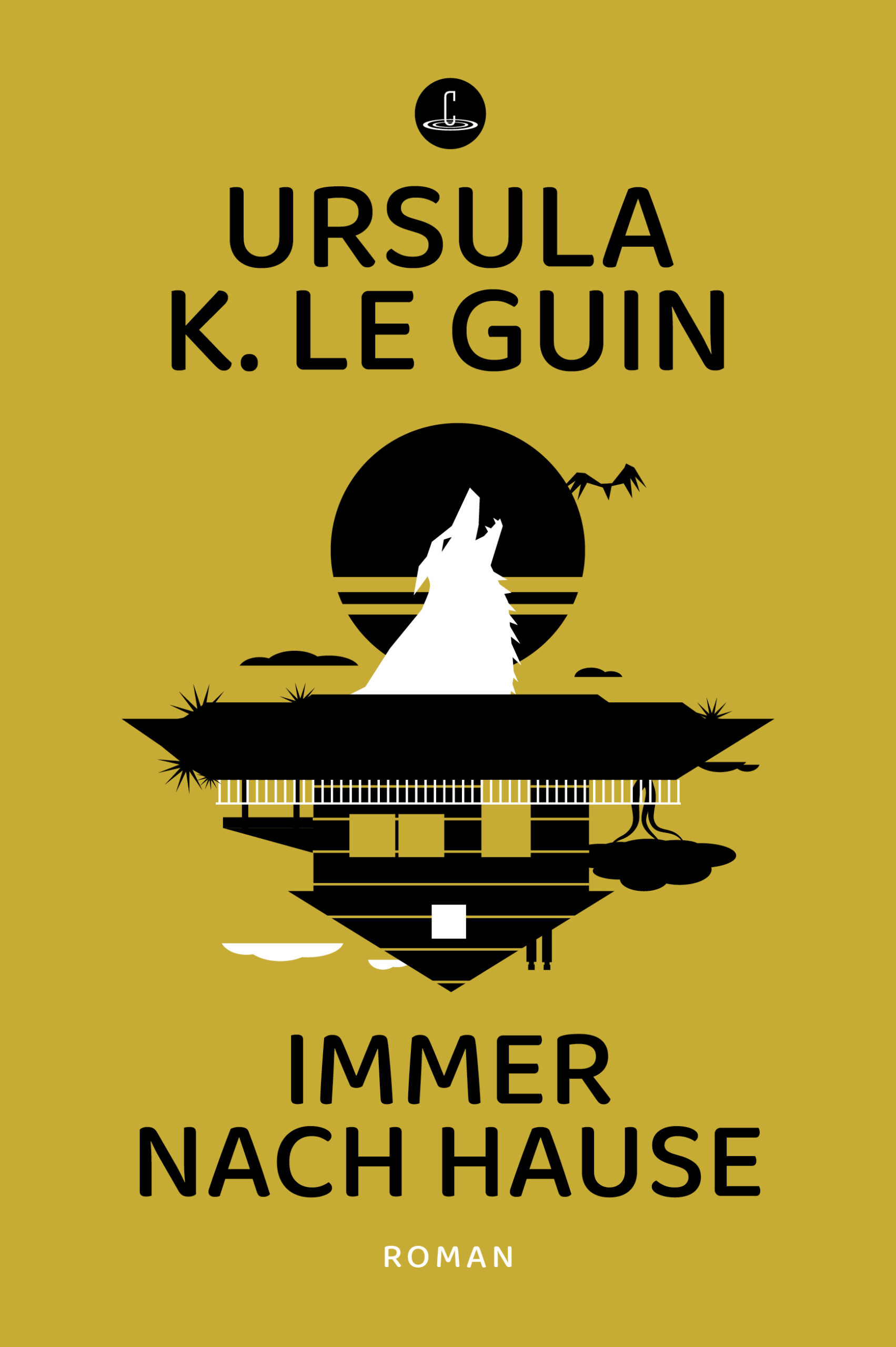 850 Seiten umfasst dieser Wälzer, der definitiv nicht reisetauglich ist. Kein Wunder, dass dies meine längste Rezension wird. Die Grundidee dieses Buches gefällt mir: Le Guin tut so, als sei sie Archäologin und untersuche eine Kultur, die es erst in der Zukunft geben wird: die der Kesh. Aus Funden und Erzählungen, Überlieferungen und Ausgrabungen setzt sie die Kultur zusammen, mit beeindruckender Akribie und viel Wohlwollen für das Fremde.
850 Seiten umfasst dieser Wälzer, der definitiv nicht reisetauglich ist. Kein Wunder, dass dies meine längste Rezension wird. Die Grundidee dieses Buches gefällt mir: Le Guin tut so, als sei sie Archäologin und untersuche eine Kultur, die es erst in der Zukunft geben wird: die der Kesh. Aus Funden und Erzählungen, Überlieferungen und Ausgrabungen setzt sie die Kultur zusammen, mit beeindruckender Akribie und viel Wohlwollen für das Fremde.
Bei genauerer Betrachtung wächst in mir aber doch die Frage, warum die Autorin sich diese Einschränkung auferlegt hat, denn aus dem Ausgraben von Hinterlassenschaften lässt sich vieles nicht ablesen. Insbesondere wenn die Kultur, wie Le Guin beschreibt, sehr suffizient und nachhaltig gelebt hat, bleiben die Bauten und Instrumente unklar, werden sie doch verrottet sein.
Auf dem Cover von „Immer nach Hause“ steht „Roman“, aber schon beim Durchblättern des Buches wird deutlich, dass sich das Buch nicht in eine solche formale Kategorie einordnen lässt. Die Textsammlung beginnt mit einer konzeptuellen Einführung, dann folgt ein Lied(text), dann der erste Teil der Geschichte einer Person namens Erzählstein. Es handelt sich um einen slice of live Bericht einer zunächst zum großen Teil unverständlichen fiktiven Kultur, ein Bericht, von dem unklar ist, wie er archäologisch zu finden sein könnte. Le Guin sprengt hier also gleich am Anfang die selbst auferlegten Grenzen. Trotz Le Guins schöner Sprache zieht sich der Bericht dann doch ganz schön in die Länge, zumal ich einen Spannungsbogen vergeblich suchte.
Inhaltlich geht es um ein Kind, das ausgeschlossen und gehänselt wird, weil es anders ist. Im Laufe des Textes wird deutlich, dass das Andere der abwesende Vater ist, der aus einer anderen Region stammt. Hier geht es also um Rassismus, von dem das Kind betroffen ist. Die wenig sensiblen Erziehungspersonen beschützen es weder, noch beantworten sie die Fragen des Kindes. So ist es einsam und allein gelassen und kann sich seine Herkunft erst ein Stück weit erschließen, als nach neun Jahren der unbekannte Vater plötzlich in der Tür steht. Er ist Soldat und das Mädchen folgt ihm ein wenig in seine Welt, jedoch ohne dass sich ein Erwachsener die Mühe macht, seine zahlreichen Fragen zu beantworten. Wieder wird es alleingelassen und nun schwebt noch die Gefahr eines Krieges am Horizont – da war ich schon einigermaßen erstaunt. Denn das alles sind Dinge, die für mich gewiss nicht zu einer Utopie gehören. Für wen ist also das Leben der Kesh eine Utopie, wenn schon ein Kind mit einem fremden Vater ausgeschlossen wird?

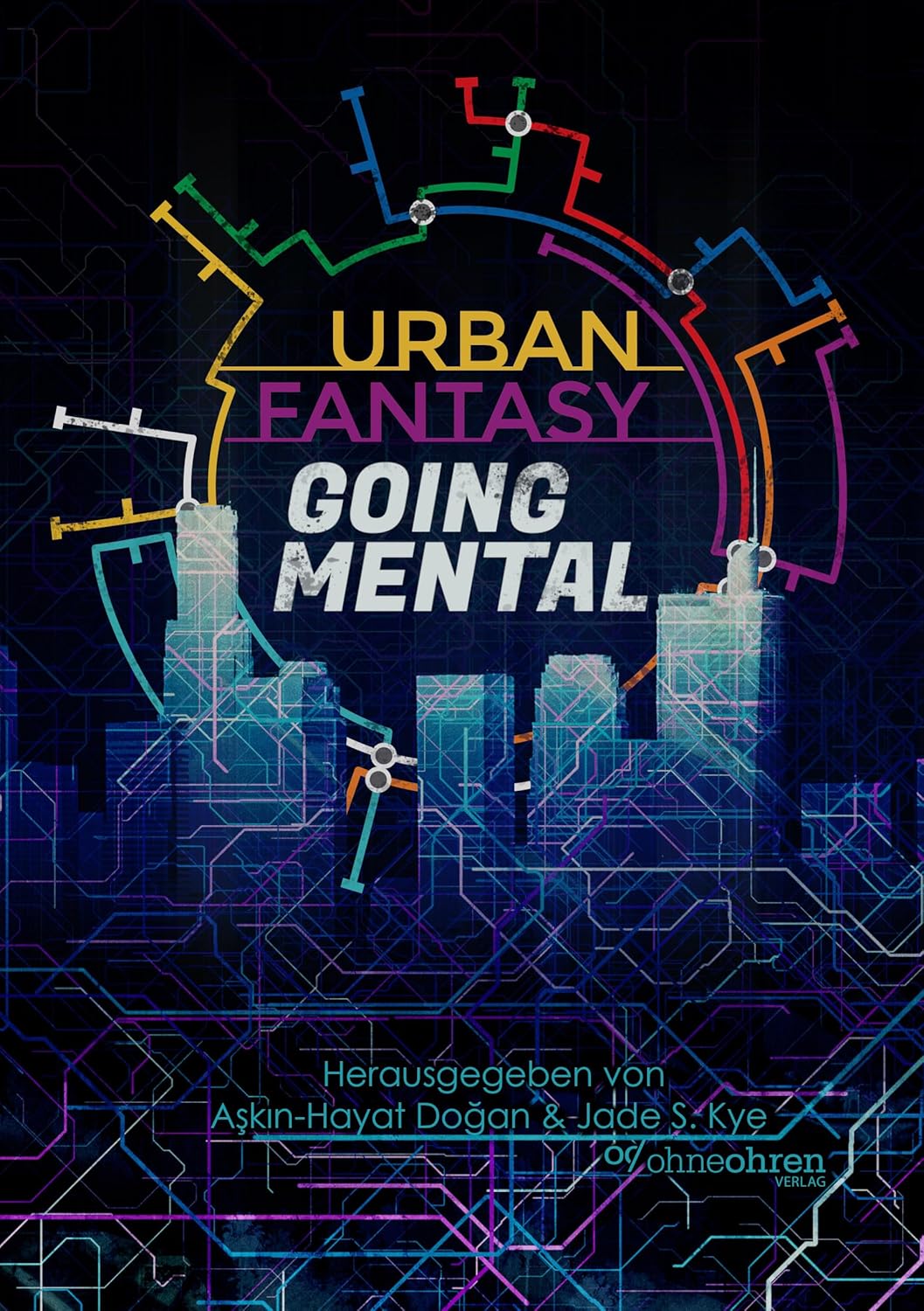 Gemeinsam mit verschiedenen Co-Herausgeber*innen hat Aşkın-Hayat Doğan bereits mehrere „Urban Fantasy going …“ -Anthologien herausgegeben. Den Beginn machte „Urban Fantasy going queer“ zusammen mit Noah Stoffers bei Art Skript Fantastik (und darum leider nicht mehr erhältlich), dann folgte „Urban Fantasy going fat“ zusammen mit Elea Brandt bei ohneohren. Diesmal geht es um psychische Erkrankungen, das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen.
Gemeinsam mit verschiedenen Co-Herausgeber*innen hat Aşkın-Hayat Doğan bereits mehrere „Urban Fantasy going …“ -Anthologien herausgegeben. Den Beginn machte „Urban Fantasy going queer“ zusammen mit Noah Stoffers bei Art Skript Fantastik (und darum leider nicht mehr erhältlich), dann folgte „Urban Fantasy going fat“ zusammen mit Elea Brandt bei ohneohren. Diesmal geht es um psychische Erkrankungen, das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen.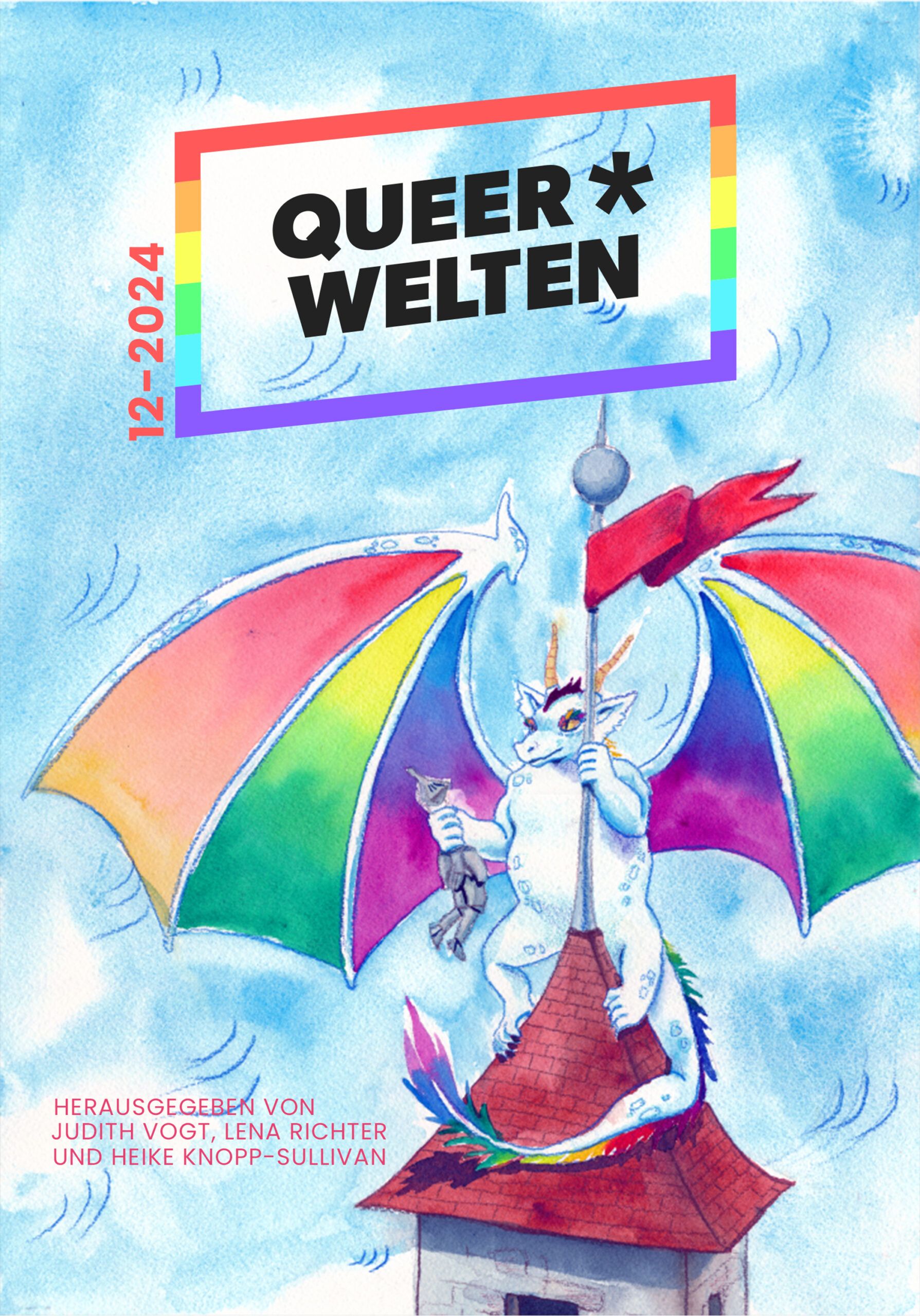
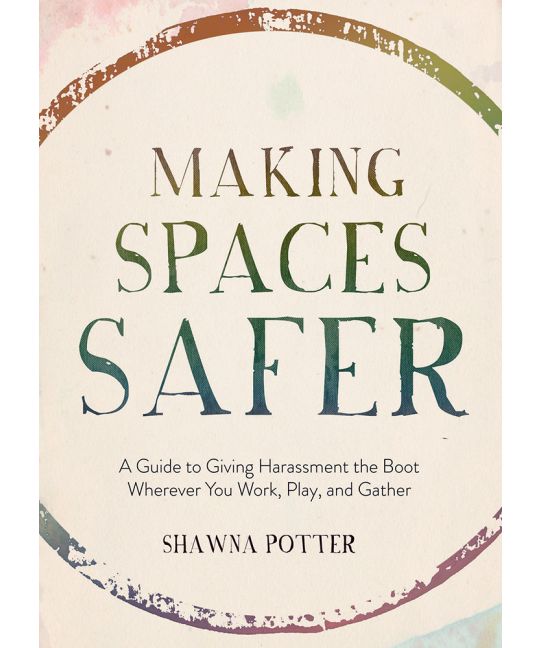 Shawna Potter, Band-Frontperson von „War on Women“ aus Baltimore, arbeitet seit über zehn Jahren daran, Gemeinschaften lebendiger und sicherer für alle zu machen. Sie gibt dazu Seminare und hat mit diesem Buch ihre Erfahrungen und Anregungen für alle zugänglich gemacht. Das Buch ist auf englisch über
Shawna Potter, Band-Frontperson von „War on Women“ aus Baltimore, arbeitet seit über zehn Jahren daran, Gemeinschaften lebendiger und sicherer für alle zu machen. Sie gibt dazu Seminare und hat mit diesem Buch ihre Erfahrungen und Anregungen für alle zugänglich gemacht. Das Buch ist auf englisch über  Im Vorwort dankt Uwe Post den Käufer*innen des Magazins und verdeutlicht, wie schwer es sei, geeignete deutschsprachige Texte zu finden, die einen positiven Zukunftsausblick enthalten.
Im Vorwort dankt Uwe Post den Käufer*innen des Magazins und verdeutlicht, wie schwer es sei, geeignete deutschsprachige Texte zu finden, die einen positiven Zukunftsausblick enthalten.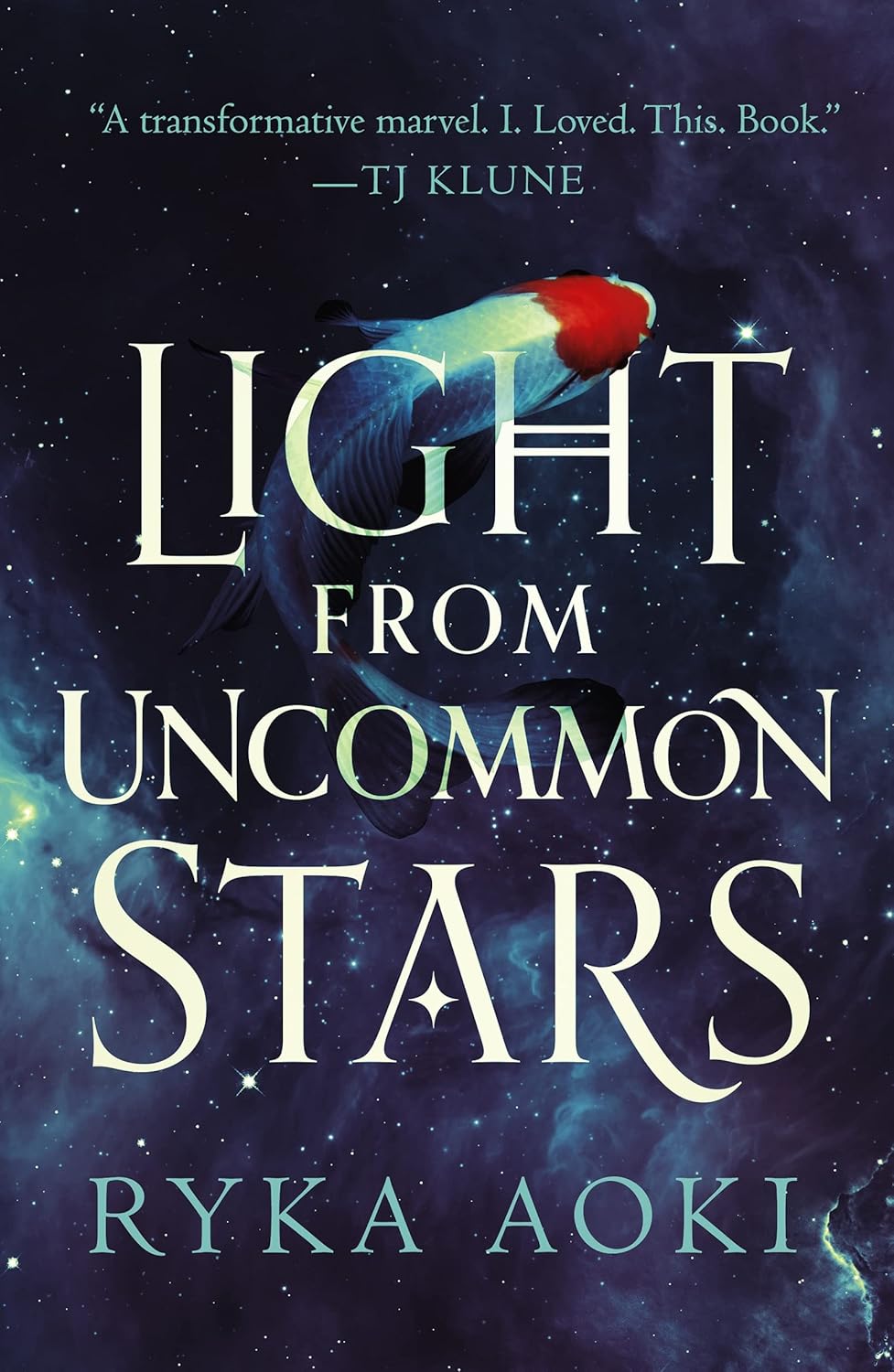
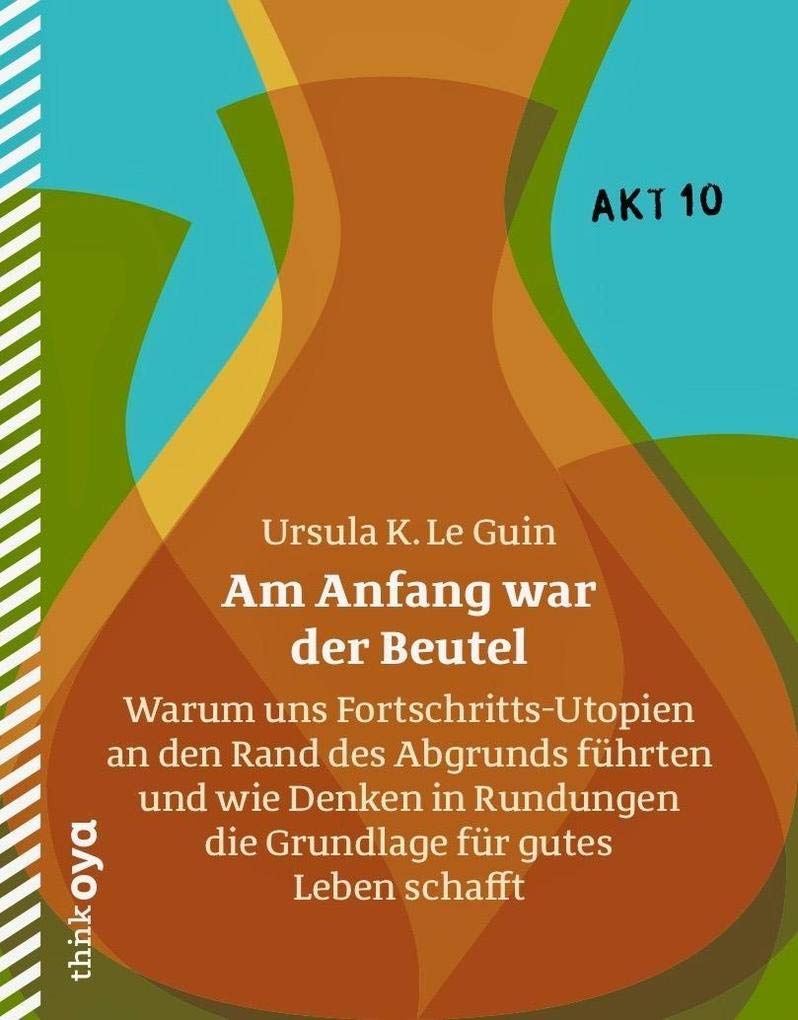
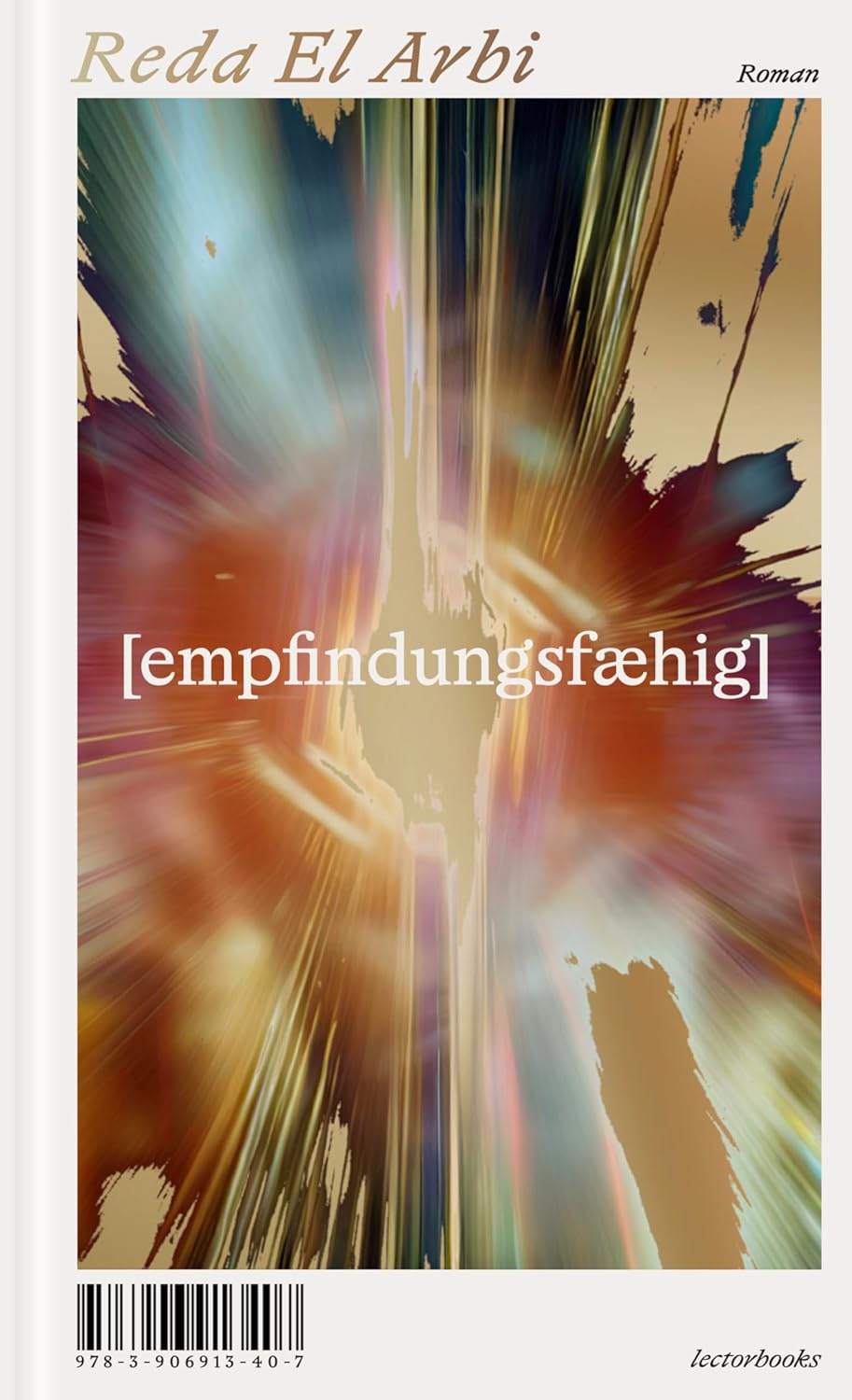 Der Schweizer Autor El Arbi schafft es schon in den ersten Zeilen, Stimmung zu erzeugen: Eine Ermittlerin schleicht durch einen alten Keller, um auf eigene Faust Kriminelle zu erlegen. Ich kann den Keller förmlich riechen und bin auch gleich in die Spannung hineingesogen, auch wenn ich mich frage, warum sie ausgerechnet morden möchte und wie ich das finde.
Der Schweizer Autor El Arbi schafft es schon in den ersten Zeilen, Stimmung zu erzeugen: Eine Ermittlerin schleicht durch einen alten Keller, um auf eigene Faust Kriminelle zu erlegen. Ich kann den Keller förmlich riechen und bin auch gleich in die Spannung hineingesogen, auch wenn ich mich frage, warum sie ausgerechnet morden möchte und wie ich das finde.